Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel | |
|---|---|
 Portrait (1831) by Jakob Schlesinger | |
| Geboren | 27 August 1770 Stuttgart, Duchy of Württemberg, Holy Roman Empire |
| Gestorben | 14 November 1831 (aged 61) Berlin, Kingdom of Prussia |
| Education |
|
| Notable work |
|
| Spouse |
Marie Helena Susanna von Tucher
(m. 1811) |
| Children | 3, including Karl and Immanuel |
| Era | 19th-century philosophy |
| Region | Western philosophy |
| School |
|
| Institutions |
|
| Thesis | Dissertatio Philosophica de Orbitis Planetarium (Philosophical Dissertation on the Orbits of the Planets) (1801) |
| Academic advisors | J. F. LeBret (M.A. advisor) |
Main interests |
|
| Signature | |
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27. August 1770 - 14. November 1831) war ein deutscher Philosoph und einer der einflussreichsten Vertreter des deutschen Idealismus und der Philosophie des 19. Jahrhunderts. Sein Einfluss erstreckt sich auf das gesamte Spektrum zeitgenössischer philosophischer Themen, von metaphysischen Fragen der Erkenntnistheorie und Ontologie bis hin zur politischen Philosophie, Geschichtsphilosophie, Kunstphilosophie, Religionsphilosophie und Geschichte der Philosophie.
Hegel wurde 1770 in Stuttgart im Heiligen Römischen Reich geboren, in der Übergangszeit zwischen der Aufklärung und der romantischen Bewegung in den germanischen Regionen Europas. Er erlebte die Französische Revolution und die Napoleonischen Kriege und wurde von ihnen beeinflusst. Sein Ruhm beruht vor allem auf der „Phänomenologie des Geistes“, der „Wissenschaft der Logik“, seiner teleologischen Darstellung der Geschichte und seinen Vorlesungen an der Universität Berlin zu Themen aus seiner „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“.
In seinem gesamten Werk bemühte sich Hegel, die problematischen Dualismen der modernen Philosophie (Immanuel Kant und andere) zu korrigieren, indem er sich auf die antike Philosophie, insbesondere Aristoteles, stützte. Hegel besteht überall darauf, dass Vernunft und Freiheit historische Errungenschaften und keine natürlichen Gegebenheiten sind. Sein dialektisch-spekulatives Verfahren beruht auf dem Prinzip der Immanenz, d.h. auf der Beurteilung von Behauptungen immer nach ihren eigenen internen Kriterien. Indem er den Skeptizismus ernst nimmt, behauptet er, dass der Mensch keine Wahrheiten voraussetzen kann, die den Test der Erfahrung nicht bestanden haben; selbst die „apriorischen“ Kategorien der „Logik“ müssen ihre „Verifizierung“ in der natürlichen Welt und den historischen Errungenschaften der Menschheit erlangen.
Geleitet von dem delphischen Imperativ „Erkenne dich selbst“, stellt Hegel die freie Selbstbestimmung als das Wesen des Menschen dar - eine Schlussfolgerung aus seiner „Phänomenologie“ von 1806-07, die er durch die systematische Darstellung der Interdependenz von Logik, Natur und Geist in seiner späteren „Enzyklopädie“ bestätigt sieht. Er behauptet, dass die „Logik“ die Dualismen des Materiellen und des Geistigen gleichzeitig bewahrt und überwindet - das heißt, sie erklärt sowohl die Kontinuität als auch die Differenz, die die Bereiche von Natur und Kultur kennzeichnen - als eine metaphysisch notwendige und kohärente „Identität von Identität und Nicht-Identität“.
Leben
Prägende Jahre
Stuttgart, Tübingen, Bern, Frankfurt (1770-1800)

Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart, der Hauptstadt des Herzogtums Württemberg im Heiligen Römischen Reich (heute Südwestdeutschland), geboren. Er wurde auf den Namen Georg Wilhelm Friedrich getauft, wurde aber von seiner Familie Wilhelm genannt. Sein Vater, Georg Ludwig Hegel (1733-1799), war Sekretär des Finanzamts am Hof von Karl Eugen, Herzog von Württemberg. Hegels Mutter, Maria Magdalena Louisa Hegel, geborene Fromm (1741-1783), war die Tochter des württembergischen Oberhofgerichtsrats Ludwig Albrecht Fromm (1696-1758). Sie starb an einem Gallenfieber, als Hegel dreizehn Jahre alt war. Hegel und sein Vater erkrankten ebenfalls an der Krankheit, überlebten sie aber nur knapp. Hegel hatte eine Schwester, Chistiane Luise (1773-1832); und einen Bruder, Georg Ludwig (1776-1812), der als Offizier während Napoleons Russlandfeldzug 1812 ums Leben kam. Im Alter von drei Jahren besuchte Hegel die Deutsche Schule. Als er zwei Jahre später in die Lateinschule eintrat, kannte er bereits die erste Deklination, da er sie von seiner Mutter gelernt hatte. 1776 trat er in das Stuttgarter Eberhard-Ludwigs-Gymnasium ein und las während seiner Jugend unersättlich und schrieb lange Auszüge in sein Tagebuch. Zu den Autoren, die er las, gehörten der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock und Schriftsteller der Aufklärung wie Christian Garve und Gotthold Ephraim Lessing. Hegels erster Biograph Karl Rosenkranz beschrieb 1844 die dortige Ausbildung des jungen Hegels mit den Worten, sie gehöre „vom Prinzip her ganz der Aufklärung, vom Lehrplan her ganz der klassischen Antike“. Sein Studium am „Gymnasium“ schloss er mit seiner Abschlussrede „Der missglückte Zustand der Kunst und Wissenschaft in der Türkei“ ab.

Im Alter von achtzehn Jahren trat Hegel in das Tübinger Stift ein, ein protestantisches Seminar, das der Universität Tübingen angegliedert war, wo er den Dichter und Philosophen Friedrich Hölderlin und den späteren Philosophen Friedrich Schelling als Zimmergenossen hatte. Die drei teilten die Abneigung gegen das ihrer Meinung nach restriktive Umfeld des Seminars, wurden aber enge Freunde und beeinflussten sich gegenseitig in ihren Ideen. (Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hegel das „Stift“ besuchte, weil es staatlich finanziert wurde, denn er hatte „eine tiefe Abneigung gegen das Studium der orthodoxen Theologie“ und wollte nie Pfarrer werden.) Alle drei bewunderten die hellenische Zivilisation sehr, und Hegel vertiefte sich in dieser Zeit zusätzlich in Jean-Jacques Rousseau und Lessing. Sie verfolgten die Entwicklung der Französischen Revolution mit der gleichen Begeisterung. Obwohl die Gewalt der Schreckensherrschaft von 1793 Hegels Hoffnungen dämpfte, identifizierte er sich weiterhin mit der gemäßigten Girondin-Fraktion und verlor nie sein Bekenntnis zu den Prinzipien von 1789, was er dadurch zum Ausdruck brachte, dass er an jedem vierzehnten Juli auf die Erstürmung der Bastille anstieß. Schelling und Hölderlin vertiefen sich in theoretische Debatten über die kantische Philosophie, von denen Hegel sich fernhält. Hegel sah zu dieser Zeit seine Zukunft als „Popularphilosoph“, der dazu dient, die abstrusen Ideen der Philosophen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen; sein eigenes Bedürfnis, sich kritisch mit den zentralen Ideen des Kantianismus auseinanderzusetzen, sollte erst um 1800 entstehen.

Nach seinem theologischen Examen am Tübinger Priesterseminar wurde Hegel „Hofmeister“ bei einer adligen Familie in Bern (1793-1796). In dieser Zeit verfasste er den Text, der als „Leben Jesu“ bekannt geworden ist, und ein buchfüllendes Manuskript mit dem Titel „Die Positivität der christlichen Religion“. Da das Verhältnis zu seinen Arbeitgebern angespannt war, nahm Hegel 1797 ein von Hölderlin vermitteltes Angebot an, eine ähnliche Stelle bei einer Weinhändlerfamilie in Frankfurt anzunehmen. Dort übte Hölderlin einen wichtigen Einfluss auf Hegels Denken aus. Während Hegel in Bern das orthodoxe Christentum scharf kritisiert hatte, vollzog er in Frankfurt unter dem Einfluss der Frühromantik eine Art Umkehr und erforschte insbesondere die mystische Erfahrung der Liebe als das wahre Wesen der Religion. Ebenfalls 1797 entstand das unveröffentlichte und unsignierte Manuskript „Das älteste systematische Programm des deutschen Idealismus“. Es wurde von Hegels Hand geschrieben, könnte aber auch von Hegel, Schelling oder Hölderlin verfasst worden sein. Während seines Aufenthalts in Frankfurt verfasste Hegel den Aufsatz „Fragmente über Religion und Liebe“. 1799 schrieb er einen weiteren Aufsatz mit dem Titel „Der Geist des Christentums und sein Schicksal“, der zu seinen Lebzeiten unveröffentlicht blieb.
Karrierejahre
Jena, Bamberg, Nürnberg (1801-1816)

Im Jahr 1801 kam Hegel auf Anregung von Schelling, der an der Universität Jena eine außerordentliche Professur innehatte, nach Jena. Hegel erhielt eine Stelle als Privatdozent an der Universität Jena, nachdem er die Antrittsdissertation „De Orbitis Planetarum“ vorgelegt hatte, in der er kurz die mathematischen Argumente kritisierte, die besagen, dass es einen Planeten zwischen Mars und Jupiter geben muss. Später im Jahr wird Hegels Aufsatz „Der Unterschied zwischen Fichtes und Schellings System der Philosophie“ fertiggestellt. Er hielt Vorlesungen über „Logik und Metaphysik“ und hielt zusammen mit Schelling Vorlesungen über eine „Einführung in die Idee und die Grenzen der wahren Philosophie“ und veranstaltete ein „philosophisches Disputorium“. 1802 gründeten Schelling und Hegel die Zeitschrift Kritische Journal der Philosophie, an der sie bis zur Beendigung der Zusammenarbeit mitarbeiteten, als Schelling 1803 nach Würzburg ging. 1805 beförderte die Universität Hegel zum außerordentlichen Professor, nachdem er in einem Brief an den Dichter und Kultusminister Johann Wolfgang von Goethe gegen die Beförderung seines philosophischen Gegners Jakob Friedrich Fries protestiert hatte. Hegel versuchte, mit Hilfe des Dichters und Übersetzers Johann Heinrich Voß eine Stelle an der wiedererstehenden Universität Heidelberg zu erhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Zu seinem Leidwesen wurde Fries noch im selben Jahr zum ordentlichen Professor (mit Gehalt) ernannt. Im darauf folgenden Februar wurde Hegels unehelicher Sohn Georg Ludwig Friedrich Fischer (1807-1831) geboren, der aus einer Affäre mit Hegels Vermieterin Christiana Burkhardt, geb. Fischer, hervorging. Da seine finanziellen Mittel schnell versiegten, stand Hegel unter großem Druck, sein Buch, die lang versprochene Einführung in sein philosophisches System, abzuliefern. Hegel war gerade dabei, die „Phänomenologie des Geistes“ fertig zu stellen, als Napoleon am 14. Oktober 1806 die preußischen Truppen in der Schlacht bei Jena auf einer Hochebene außerhalb der Stadt angriff. Am Tag vor der Schlacht marschierte Napoleon in die Stadt Jena ein. Hegel schilderte seine Eindrücke in einem Brief an seinen Freund Friedrich Immanuel Niethammer:

Ich sah den Kaiser - diese Weltseele [Weltseele] - auf Erkundung aus der Stadt reiten. Es ist in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das, hier auf einen einzigen Punkt konzentriert, rittlings auf einem Pferd, die Welt umgreift und sie beherrscht.
Der Hegel-Biograph Terry Pinkard stellt fest, dass Hegels Bemerkung gegenüber Niethammer „umso bemerkenswerter ist, als er bereits den entscheidenden Abschnitt der Phänomenologie“ verfasst hatte, in dem er bemerkte, dass die Revolution nun offiziell in ein anderes Land (Deutschland) übergegangen sei, das „in Gedanken“ vollenden würde, was die Revolution in der Praxis nur teilweise erreicht hatte. Obwohl Napoleon die Universität Jena von einem Großteil der Zerstörung der umliegenden Stadt verschont hatte, kehrten nur wenige Studenten nach der Schlacht zurück und die Einschreibungszahlen sanken, was Hegels finanzielle Aussichten noch weiter verschlechterte. Hegel reiste im Winter nach Bamberg und blieb bei Niethammer, um die Korrekturen der „Phänomenologie“ zu beaufsichtigen, die dort gerade gedruckt wurde. Obwohl Hegel sich um eine andere Professur bemühte und sogar an Goethe schrieb, um eine feste Stelle als Ersatz für einen Professor der Botanik zu bekommen, gelang es ihm nicht, eine feste Stelle zu finden. Im Jahr 1807 musste er nach Bamberg umziehen, da seine Ersparnisse und die Einnahmen aus der „Phänomenologie“ aufgebraucht waren und er Geld für den Unterhalt seines unehelichen Sohnes Ludwig benötigte. Dort wurde er Redakteur der lokalen Zeitung Bamberger Zeitung, eine Position, die er mit Hilfe von Niethammer erlangte. Ludwig Fischer und seine Mutter blieben in Jena zurück.

In Bamberg, als Redakteur der Bamberger Zeitung, die eine pro-französische Zeitung war, pries Hegel die Tugenden Napoleons an und redigierte oft die preußischen Berichte über den Krieg. Als Redakteur einer lokalen Zeitung wurde Hegel auch zu einer wichtigen Person im Bamberger Gesellschaftsleben, besuchte oft den örtlichen Beamten Johann Heinrich Liebeskind, wurde in den lokalen Klatsch und Tratsch verwickelt und ging seinen Leidenschaften für Karten, gutes Essen und das lokale Bamberger Bier nach. Hegel verachtete jedoch das „alte Bayern“, das er häufig als „Barbaria“ bezeichnete, und befürchtete, dass „Heimatstädte“ wie Bamberg ihre Autonomie unter dem neuen bayerischen Staat verlieren würden. Nachdem der bayerische Staat im September 1808 ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet hatte, weil er durch die Veröffentlichung französischer Truppenbewegungen möglicherweise gegen die Sicherheitsvorschriften verstoßen hatte, schrieb Hegel an Niethammer, der inzwischen hoher Beamter in München war, und bat ihn um Hilfe bei der Suche nach einer Lehrerstelle. Mit Niethammers Hilfe wurde Hegel im November 1808 zum Rektor eines Gymnasiums in Nürnberg ernannt, eine Stelle, die er bis 1816 innehatte. In Nürnberg überarbeitete Hegel seine kurz zuvor veröffentlichte „Phänomenologie des Geistes“ für den Einsatz im Unterricht. Zu seinen Aufgaben gehörte es, eine Vorlesung mit dem Titel „Einführung in die Erkenntnis des allgemeinen Zusammenhangs der Wissenschaften“ zu halten. 1811 heiratete Hegel Marie Helena Susanna von Tucher (1791-1855), die älteste Tochter eines Senators. In diese Zeit fällt die Veröffentlichung seines zweiten Hauptwerks, der Wissenschaft der Logik (3 Bde., 1812, 1813 und 1816), und die Geburt zweier Söhne, Karl Friedrich Wilhelm (1813-1901) und Immanuel Thomas Christian (1814-1891).
Heidelberg, Berlin (1816-1831)
Nachdem ihm die Universitäten Erlangen, Berlin und Heidelberg eine Stelle angeboten hatten, entschied sich Hegel für Heidelberg, wohin er 1816 zog. Bald darauf trat sein unehelicher Sohn Ludwig Fischer (inzwischen zehn Jahre alt) im April 1817 in den Haushalt Hegels ein, nachdem er nach dem Tod seiner Mutter Christiana Burkhardt einige Zeit in einem Waisenhaus verbracht hatte. 1817 veröffentlichte Hegel die „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Umriss“ als Zusammenfassung seiner Philosophie für Studenten, die seine Vorlesungen in Heidelberg besuchten. In Heidelberg hielt Hegel auch seine erste Vorlesung über die Philosophie der Kunst. 1818 nahm Hegel den erneuten Ruf auf den Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Berlin an, der seit dem Tod Johann Gottlieb Fichtes 1814 unbesetzt geblieben war. Hier veröffentlichte Hegel seine „Elemente der Philosophie des Rechts“ (1821). Hegel widmete sich vor allem der Vortragstätigkeit; seine Vorlesungen über die Philosophie der schönen Künste, die Religionsphilosophie, die Geschichtsphilosophie und die Geschichte der Philosophie wurden posthum aus den Notizen der Studenten veröffentlicht. Trotz seiner notorisch schlechten Vortragsweise verbreitete sich sein Ruhm und seine Vorlesungen zogen Studenten aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. In der Zwischenzeit wurden Hegel und seine Schüler, wie Leopold von Henning und Friedrich Wilhelm Carové, von Fürst Sayn-Wittgenstein, dem Innenminister Preußens, und seinen reaktionären Kreisen am preußischen Hof schikaniert und unter Beobachtung gestellt. In der verbleibenden Zeit seiner Karriere unternahm er zwei Reisen nach Weimar, wo er zum letzten Mal mit Goethe zusammentraf, sowie nach Brüssel, in die nördlichen Niederlande, nach Leipzig, Wien, Prag und Paris.

In den letzten zehn Jahren seines Lebens veröffentlichte Hegel kein weiteres Buch mehr, sondern überarbeitete die „Enzyklopädie“ gründlich (zweite Auflage 1827, dritte Auflage 1830). In seiner politischen Philosophie kritisierte er das reaktionäre Werk von Karl Ludwig von Haller, der behauptete, Gesetze seien nicht notwendig. Eine Reihe weiterer Werke zur Geschichtsphilosophie, Religion, Ästhetik und Geschichte der Philosophie wurden aus den Vorlesungsmitschriften seiner Schüler zusammengestellt und posthum veröffentlicht.
Im Oktober 1829 wurde Hegel zum Rektor der Universität ernannt, doch seine Amtszeit endete im September 1830. Hegel war von den Reformunruhen in Berlin in jenem Jahr zutiefst beunruhigt. 1831 wurde er von Friedrich Wilhelm III. für seine Verdienste um den preußischen Staat mit dem Roten Adlerorden 3. Im August 1831 erreichte eine Choleraepidemie Berlin, woraufhin Hegel die Stadt verließ und sich in Kreuzberg einquartierte. Da Hegel nun gesundheitlich geschwächt war, ging er nur noch selten aus. Als im Oktober das neue Semester begann, kehrte Hegel nach Berlin zurück, in dem Irrglauben, die Epidemie sei weitgehend abgeklungen. Am 14. November war Hegel tot. Die Ärzte gaben als Todesursache die Cholera an, aber wahrscheinlich starb er an einer anderen Magen-Darm-Erkrankung. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: „Es gab nur einen einzigen Menschen, der mich je verstanden hat, und selbst der hat mich nicht verstanden.“ Er wurde am 16. November beigesetzt. Seinem Wunsch entsprechend wurde Hegel auf dem Dorotheenstädter Friedhof neben Fichte und Karl Wilhelm Ferdinand Solger beigesetzt.
Hegels unehelicher Sohn, Ludwig Fischer, war kurz zuvor in Batavia bei der niederländischen Armee gefallen, und die Nachricht von seinem Tod erreichte seinen Vater nie. Anfang des folgenden Jahres beging Hegels Schwester Christiane durch Ertrinken Selbstmord. Hegels zwei verbliebene Söhne - Karl, der Historiker wurde, und Immanuel, der einen theologischen Weg einschlug - lebten lange und bewahrten die Manuskripte und Briefe ihres Vaters und gaben Ausgaben seiner Werke heraus.
Einflüsse

Wie H. S. Harris berichtet, war Hegel, als er 1788 in das Tübinger Seminar eintrat, „ein typisches Produkt der deutschen Aufklärung - ein begeisterter Leser von Rousseau und Lessing, vertraut mit Kant (zumindest aus zweiter Hand), aber vielleicht mehr den Klassikern zugetan als irgendetwas Modernem.“ In dieser frühen Periode seines Lebens „standen die Griechen - besonders Platon - an erster Stelle“. Obwohl er später Aristoteles über Platon erhob, gab Hegel seine Liebe zur antiken Philosophie nie auf, deren Spuren in seinem Denken überall zu finden sind.
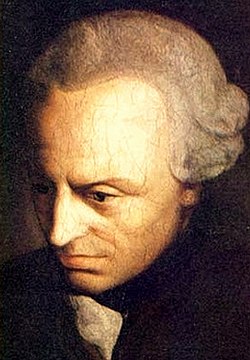
Hegels Beschäftigung mit verschiedenen Formen kultureller Einheit (jüdisch, griechisch, mittelalterlich und modern) während dieser frühen Periode sollte ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Auf diese Weise war er auch ein typisches Produkt der deutschen Frühromantik. „Einheit des Lebens“ war der Begriff, mit dem Hegel und seine Generation ihre Vorstellung vom höchsten Gut zum Ausdruck brachten. Sie umfasst die Einheit „mit sich selbst, mit anderen und mit der Natur“. Die Hauptbedrohung dieser Einheit besteht in der Entzweiung oder der Entfremdung.“
In dieser Hinsicht war Hegel besonders von dem Phänomen der Liebe als einer Art „Einheit in der Differenz“ angetan, und zwar sowohl in der antiken Artikulation, die von Platon geliefert wurde, als auch in der Lehre der christlichen Religion von der Agape, die Hegel zu dieser Zeit als „bereits auf der universellen Vernunft begründet“ ansah.'" Dieses Interesse sowie seine theologische Ausbildung sollten sein Denken weiterhin prägen, auch wenn es sich in eine mehr theoretische oder metaphysische Richtung entwickelte.
Laut Glenn Alexander Magee verdankt Hegels Denken (insbesondere die dreigliedrige Struktur seines Systems) auch viel der hermetischen Tradition, vor allem dem Werk von Jakob Böhme. Die Überzeugung, dass die Philosophie die Form eines Systems annehmen muss, verdankt Hegel vor allem seinen Tübinger Mitbewohnern, Schelling und Hölderlin.
Hegel las auch viel und wurde von Adam Smith und anderen Theoretikern der politischen Ökonomie stark beeinflusst.
Es war Kants kritische Philosophie, die Hegel als die endgültige moderne Artikulation der zu überwindenden Spaltungen ansah. Dies führte dazu, dass er sich mit den philosophischen Programmen von Fichte und Schelling auseinandersetzte und sich mit Spinoza und der Pantheismus-Kontroverse befasste. Der Einfluss von Johann Gottfried von Herder führte Hegel jedoch zu einer qualifizierten Ablehnung des Universalitätsanspruchs des kantischen Programms zugunsten einer stärker kulturell, sprachlich und historisch informierten Darstellung der Vernunft.
Die Phänomenologie des Geistes
Die Phänomenologie des Geistes wurde im Jahr 1807 veröffentlicht. Im Alter von sechsunddreißig Jahren legt Hegel darin zum ersten Mal „seinen eigenen, unverwechselbaren Ansatz“ dar und wendet sich mit einer „erkennbar ‚hegelianischen‘ Sichtweise den philosophischen Problemen der nachkantischen Philosophie zu“. Dennoch wurde das Buch selbst von Hegels Zeitgenossen kaum verstanden und erhielt überwiegend negative Kritiken. Bis heute ist die „Phänomenologie“ unter anderem wegen ihrer begrifflichen und anspielungsreichen Dichte, ihrer eigenwilligen Terminologie und ihrer verwirrenden Übergänge berüchtigt. Ihr umfassendster Kommentar, der zweibändige Kommentar des Gelehrten H. S. Harris („The Pilgrimage of Reason“ und „The Odyssey of Spirit“), ist mehr als dreimal so lang wie der Text selbst.
Das vierte Kapitel der Phänomenologie enthält Hegels erste Darstellung der Dialektik zwischen Herr und Knecht, der Abschnitt des Buches, der in der allgemeinen Kultur am einflussreichsten war. Was in dem von Hegel dargestellten Konflikt auf dem Spiel steht, ist die praktische (nicht theoretische) Anerkennung der Universalität - d.h. des Personseins, der Menschlichkeit - eines jeden der beiden gegensätzlichen Selbstbewusstseine. Was der Leser erfährt, was aber die beschriebenen Selbstbewusstseine noch nicht erkennen, ist, dass Anerkennung nur als reziproke oder wechselseitige Anerkennung erfolgreich und tatsächlich sein kann. Dies ist aus dem einfachen Grund der Fall, dass die Anerkennung eines Menschen, den man nicht als richtigen Menschen anerkennt, nicht als echte Anerkennung gelten kann. Hegel kann hier auch als Kritiker der individualistischen Weltanschauung gesehen werden, die den Menschen und die Gesellschaft als eine Ansammlung atomisierter Individuen ansieht und stattdessen eine ganzheitliche Sichtweise des menschlichen Selbstbewusstseins vertritt, die die Anerkennung anderer voraussetzt und das Selbstverständnis der Menschen als von den Ansichten anderer geprägt betrachtet.

Hegel beschreibt die „Phänomenologie“ sowohl als „Einführung“ in sein philosophisches System als auch als den „ersten Teil“ dieses Systems als „Wissenschaft von der Erfahrung des Bewusstseins“. Dennoch ist sie in beiderlei Hinsicht seit langem umstritten; tatsächlich änderte sich Hegels eigene Haltung im Laufe seines Lebens.
Wie kompliziert auch immer die Details sein mögen, die grundlegende Strategie, mit der er versucht, seinen einleitenden Anspruch einzulösen, ist nicht schwer zu erklären. Ausgehend von den grundlegendsten „Gewissheiten des Bewusstseins selbst“, „von denen die unmittelbarste die Gewissheit ist, dass ‚‘ich‚‘ mir ‚‘dieses‚‘ Objekts, ‚‘hier‚‘ und ‚‘jetzt‚‘ bewusst bin“, will Hegel zeigen, dass diese „Gewissheiten des natürlichen Bewusstseins“ den Standpunkt der spekulativen Logik zur Folge haben.
Dies macht die „Phänomenologie“ jedoch nicht zu einem „Bildungsroman“. Es ist nicht das beobachtete Bewusstsein, das aus seiner Erfahrung lernt. Nur „wir“, die phänomenologischen Beobachter, sind in der Lage, von Hegels logischer Rekonstruktion der Wissenschaft der Erfahrung zu profitieren.
Die darauf folgende Dialektik ist lang und hart. Sie wird von Hegel selbst als ein „Weg der Verzweiflung“ beschrieben, auf dem sich das Selbstbewusstsein immer wieder im Irrtum befindet. Es ist der Selbstbegriff des Bewusstseins selbst, der im Bereich der Erfahrung geprüft wird, und wo dieser Begriff nicht adäquat ist, „erleidet das Selbstbewusstsein diese Gewalt durch seine eigenen Hände und bringt seine eigene beschränkte Befriedigung zu Fall.“ Denn, wie Hegel betont, kann man nicht schwimmen lernen, ohne ins Wasser zu gehen. Indem er seinen Erkenntnisbegriff auf diese Weise fortschreitend erprobt, indem er „die Erfahrung zum Maßstab der Erkenntnis macht, unternimmt Hegel nichts weniger als eine ‚transzendentale Deduktion‘ der Metaphysik.“
Im Verlauf ihrer Dialektik will die „Phänomenologie“ zeigen, dass es - weil Bewusstsein immer auch Selbstbewusstsein ist - keine „gegebenen“ Gegenstände des unmittelbaren Bewusstseins gibt, die nicht bereits durch das Denken vermittelt sind. Eine weitere Analyse der Struktur des Selbstbewusstseins zeigt, dass sowohl die soziale als auch die begriffliche Stabilität der Erfahrungswelt von Netzwerken gegenseitiger Anerkennung abhängen. Das Scheitern der Anerkennung erfordert also die Reflexion über die Vergangenheit, um zu verstehen, was in der Gegenwart von uns verlangt wird“. Für Hegel bedeutet dies letztlich, eine Interpretation der „Religion als kollektive Reflexion der modernen Gemeinschaft über das, was letztlich für sie zählt“, neu zu überdenken. Er behauptet schließlich, dass diese „historisch, sozial konstruierte philosophische Darstellung dieses ganzen Prozesses“ die Genese eines eindeutig „modernen“ Standpunkts erhellt.
Man könnte auch sagen, dass die „Phänomenologie“ Kants philosophisches Projekt der Erforschung der Fähigkeiten und Grenzen der Vernunft aufgreift. Unter dem Einfluss von Herder geht Hegel jedoch historisch vor, statt ganz a priori. Doch obwohl er historisch vorgeht, widersteht Hegel den relativistischen Konsequenzen von Herders eigenem Denken. In den Worten eines Gelehrten: „Es ist Hegels Einsicht, dass die Vernunft selbst eine Geschichte hat, dass das, was als Vernunft gilt, das Ergebnis einer Entwicklung ist. Das ist etwas, was Kant sich nicht vorstellen kann und was Herder nur andeutet.“
Walter Kaufmann schreibt in seiner Würdigung von Hegels Leistung, die leitende Überzeugung der „Phänomenologie“ sei, dass ein Philosoph „sich nicht auf einmal vertretene Anschauungen beschränken, sondern diese bis zu der menschlichen Wirklichkeit durchdringen soll, die sie widerspiegeln.“ Mit anderen Worten: Es genügt nicht, Sätze oder gar Bewusstseinsinhalte zu betrachten; „es lohnt sich, in jedem Fall zu fragen, was für ein Geist solche Sätze aufstellt, solche Ansichten vertritt und ein solches Bewusstsein hat. Mit anderen Worten, jede Anschauung ist nicht nur als akademische Möglichkeit, sondern als existentielle Wirklichkeit zu untersuchen.“
Die „Phänomenologie des Geistes“ zeigt, dass die Suche nach einem äußerlich objektiven Kriterium der Wahrheit ein Irrweg ist. Die Grenzen des Wissens liegen notwendigerweise innerhalb des Geistes selbst. Doch obwohl Theorien und Selbstkonzepte immer wieder neu bewertet, neu verhandelt und revidiert werden können, handelt es sich dabei nicht um eine rein imaginative Übung. Wissensansprüche müssen ihre eigene Angemessenheit stets in der realen historischen Erfahrung beweisen.
Obwohl Hegel in seinen Berliner Jahren die „Phänomenologie des Geistes“ aufgegeben zu haben schien, schmiedete er zum Zeitpunkt seines unerwarteten Todes tatsächlich Pläne, sie zu überarbeiten und neu zu veröffentlichen. Da Hegel nicht mehr auf Geld oder Referenzen angewiesen war, argumentiert H. S. Harris, dass „die einzige vernünftige Schlussfolgerung, die aus seiner Entscheidung, das Buch neu zu veröffentlichen, gezogen werden kann, ... ist, dass er die ‚Wissenschaft der Erfahrung‘ immer noch als ein gültiges Projekt an sich betrachtete“, für das das spätere System keine Entsprechung hat. Es gibt jedoch keinen wissenschaftlichen Konsens über die Phänomenologie in Bezug auf eine der systematischen Rollen, die Hegel zur Zeit ihrer Veröffentlichung behauptete.
Philosophisches System
Hegels philosophisches System gliedert sich in drei Teile: die Wissenschaft der Logik, die Naturphilosophie und die Philosophie des Geistes (wobei die beiden letzteren zusammen die eigentliche Philosophie bilden). Diese Gliederung ist von Proklos' neuplatonischer Trias "'verbleibend-fortschreitend-zurückkehrend' und von der christlichen Trinität übernommen.“ Obwohl das System bereits in Entwürfen aus dem Jahr 1805 zu finden ist, wurde es erst in der „Enzyklopädie“ (1. Auflage) von 1817 in veröffentlichter Form fertiggestellt.
Frederick C. Beiser argumentiert, dass die Position der Logik in Bezug auf die reale Philosophie am besten im Sinne von Hegels Aneignung von Aristoteles' Unterscheidung zwischen der „Ordnung der Erklärung“ und der „Ordnung des Seins“ zu verstehen ist. Für Beiser ist Hegel weder ein Platoniker, der an abstrakte logische Entitäten glaubt, noch ein Nominalist, dem zufolge das Partikulare in den Ordnungen der Erklärung und des Seins gleichermaßen zuerst ist. Vielmehr ist Hegel ein Holist. Für Hegel steht das Universelle in der Ordnung der Erklärung immer an erster Stelle, auch wenn das natürlich Besondere in der Ordnung des Seins an erster Stelle steht. In Bezug auf das System als Ganzes wird dieses Universelle von der Logik geliefert.
Michael J. Inwood stellt fest: „Die logische Idee ist nicht-zeitlich und existiert daher zu keinem Zeitpunkt abgesehen von ihren Manifestationen.“ Die Frage, „wann“ sie sich in Natur und Geist aufteilt, ist vergleichbar mit der Frage, „wann“ sich 12 in 5 und 7 aufteilt. Die Frage ist nicht zu beantworten, weil sie auf einem grundlegenden Missverständnis ihrer Begriffe beruht. Die Aufgabe der Logik (auf dieser hohen systemischen Ebene) besteht darin, das zu artikulieren, was Hegel „die Identität von Identität und Nicht-Identität“ von Natur und Geist nennt. Mit anderen Worten: Sie zielt darauf ab, den Subjekt-Objekt-Dualismus zu überwinden. Das heißt, dass Hegels philosophisches Projekt unter anderem versucht, die metaphysische Grundlage für eine Darstellung des Geistes zu schaffen, die mit der „bloß“ natürlichen Welt zusammenhängt und sich doch von ihr unterscheidet - ohne dabei den einen Begriff auf den anderen zu reduzieren.
Darüber hinaus legen die letzten Abschnitte von Hegels „Enzyklopädie“ nahe, dass es eine „einseitige“, unvollständige oder anderweitig ungenaue Interpretation wäre, wenn man einem der drei Teile Priorität einräumen würde. Wie Hegel berühmt erklärt: „Das Wahre ist das Ganze.“
Wissenschaft der Logik
Hegels Konzept der Logik unterscheidet sich stark von dem der gewöhnlichen englischen Bedeutung des Begriffs. Das zeigt sich zum Beispiel in solchen metaphysischen Definitionen der Logik wie „die Wissenschaft von den ‚Dingen‘, die in [den] ‚Gedanken‘ erfasst werden, die man früher für den Ausdruck der ‚Wesentlichkeiten‘ der ‚Dinge‘ hielt.“ Wie Michael Wolff erklärt, ist Hegels Logik eine Fortsetzung von Kants ausgeprägtem logischen Programm. Die gelegentliche Auseinandersetzung mit der bekannten aristotelischen Konzeption der Logik ist für Hegels Projekt nur nebensächlich. Die Entwicklungen des zwanzigsten Jahrhunderts durch Logiker wie Frege und Russell bleiben ebenfalls Logiken der formalen Gültigkeit und sind daher für Hegels Projekt, das eine metaphysische Logik der Wahrheit anstrebt, ebenfalls irrelevant.
Es gibt zwei Texte von Hegels Logik. Der erste, „Die Wissenschaft der Logik“ (1812, 1813, 1816; Bd. I, überarbeitet 1831), wird manchmal auch „Große Logik“ genannt. Der zweite ist der erste Band von Hegels „Enzyklopädie“ und wird manchmal als „Kleine Logik“ bezeichnet. Die „Enzyklopädie“-Logik ist eine verkürzte oder komprimierte Darstellung derselben Dialektik. Hegel verfasste sie für den Gebrauch mit Studenten im Hörsaal, nicht als Ersatz für die eigentliche, buchfüllende Darstellung.
Hegel stellt die Logik als eine voraussetzungslose Wissenschaft dar, die die grundlegendsten Denkbestimmungen untersucht und damit die Grundlage der Philosophie bildet. Indem man etwas in Frage stellt, setzt man die Logik bereits voraus; insofern ist sie das einzige Forschungsgebiet, das seine eigene Funktionsweise ständig reflektieren muss. Die Wissenschaft der Logik ist Hegels Versuch, dieser grundlegenden Forderung gerecht zu werden. Wie er es ausdrückt, „‚Logik‘ fällt mit ‚Metaphysik‘ zusammen“. In den Worten des Gelehrten Glenn Alexander Magee liefert die Logik „eine Darstellung der reinen Kategorien oder Ideen, die zeitlos wahr sind“ und die „die formale Struktur der Wirklichkeit selbst“ ausmachen.
Es ist jedoch wichtig zu sehen, dass Hegels metaphysisches Programm keine Rückkehr zum Leibnizianisch-Wolffschen Rationalismus ist, der von Kant kritisiert wurde, eine Kritik, die Hegel akzeptiert. Insbesondere lehnt Hegel jede Form der Metaphysik als Spekulation über das Transzendente ab. Sein Verfahren, eine Aneignung von Aristoteles' Begriff der Form, ist vollständig immanent. Ganz allgemein stimmt Hegel mit Kants Ablehnung jeder Form von Dogmatismus überein und ist auch der Meinung, dass jede zukünftige Metaphysik den Test der Kritik bestehen muss. Der Wissenschaftler Stephen Houlgate ist der Ansicht, dass Hegels Methode der immanenten logischen Entwicklung und Kritik historisch einzigartig ist.
Die Philosophin Béatrice Longuenesse vertritt die Auffassung, dass dieses Projekt in Analogie zu Kant als „untrennbar metaphysische und transzendentale Deduktion der Kategorien der Metaphysik“ verstanden werden kann. Dieser Ansatz besteht darauf, dass die Erkenntnisse der Logik nicht nach Maßstäben beurteilt werden können, die außerhalb des Denkens selbst liegen, d.h. dass „das Denken ... nicht der Spiegel der Natur ist“, und behauptet, dies zu beweisen. Dies bedeute jedoch nicht, dass diese Maßstäbe willkürlich oder subjektiv seien. Hegels Übersetzer und Gelehrter des deutschen Idealismus George di Giovanni interpretiert die „Logik“ ebenfalls (in Anlehnung an, aber auch in Opposition zu Kant) als „immanent“ transzendental; ihre Kategorien sind Hegel zufolge in das „Leben selbst“ eingebaut und definieren, was es heißt, „ein Objekt im Allgemeinen“ zu sein.
Die Bücher eins und zwei der „Logik“ sind die Lehren vom „Sein“ und vom „Wesen“. Zusammen bilden sie die „Objektive Logik“, die sich weitgehend mit der Überwindung der Annahmen der traditionellen Metaphysik beschäftigt. Buch drei ist der letzte Teil der „Logik“. Darin wird die Lehre vom „Begriff“ erörtert, die sich mit der Wiedereingliederung dieser Kategorien der Objektivität in eine durch und durch idealistische Darstellung der Wirklichkeit befasst. Stark vereinfachend beschreibt das Sein seine Begriffe so, wie sie erscheinen, das Wesen versucht, sie mit Bezug auf andere Kräfte zu erklären, und der Begriff erklärt und vereinigt beide im Sinne einer inneren Teleologie. Die Kategorien des Seins gehen von einer zur anderen „über“, da sie Gedankenbestimmungen bezeichnen, die nur äußerlich miteinander verbunden sind. Die Kategorien des Wesens „leuchten“ wechselseitig ineinander. Im Begriff schließlich hat sich das Denken als vollständig selbstreferentiell erwiesen, und so „entwickeln“ sich seine Kategorien organisch von einer zur nächsten.
Es ist also klar, dass der Begriff in Hegels technischem Sinn des Wortes kein psychologischer Begriff ist. Wenn er mit dem definitiven Artikel („der“) verwendet und manchmal durch den Begriff „logisch“ modifiziert wird, bezieht sich Hegel auf die intelligible Struktur der Wirklichkeit, wie sie in der Subjektiven Logik formuliert ist. (Wenn er jedoch im Plural verwendet wird, ist Hegels Bedeutung viel näher an der gewöhnlichen Wörterbuchbedeutung des Begriffs).
Hegels Untersuchung des Denkens zielt darauf ab, die innere Selbstunterscheidung des Denkens zu systematisieren, das heißt, wie sich die reinen Begriffe () in ihren verschiedenen Beziehungen der Implikation und Interdependenz voneinander unterscheiden. So behauptet Hegel in der Eröffnungsdialektik der „Logik“ zu zeigen, dass der Gedanke des „‚‘Seins, reinen Seins‚‘ - ohne weitere Bestimmung“ vom Begriff des „Nichts“ ununterscheidbar ist, und dass in diesem „Hin- und Hergehen“ von Sein und Nichts „‚‘jedes‚‘ sogleich in seinem Gegenteil verschwindet.‚‘“ Diese Bewegung ist weder der eine noch der andere Begriff, sondern die Kategorie des Werdens. Es gibt hier keinen Unterschied, auf den man „verweisen“ kann, nur eine Dialektik, die man beobachten und beschreiben kann.
Die letzte Kategorie der Logik ist „die Idee“. Wie beim „Begriff“ ist der Sinn dieses Begriffs für Hegel nicht psychologisch. In Anlehnung an Kant in der Kritik der reinen Vernunft geht Hegels Gebrauch vielmehr auf den griechischen eidos zurück, Platons Begriff der Form, der vollständig existent und universell ist: „Hegels ‚‘Idee‚‘ (wie Platons Idee) ist das Produkt eines Versuchs, Ontologie, Erkenntnistheorie, Bewertung usw. in einem einzigen Begriff zu verschmelzen.“
Die „Logik“ beherbergt in sich die Notwendigkeit des Bereichs der natürlich-geistigen „Kontingenz“, das, was nicht im Voraus bestimmt werden kann: „Um weiter zu gehen, muss sie das Denken ganz aufgeben und sich selbst loslassen, indem sie sich in reiner Empfänglichkeit für das öffnet, was anders ist als das Denken.“ Einfach ausgedrückt: Die Logik verwirklicht sich nur im Bereich der Natur und des Geistes, in dem sie ihre „Verifikation“ erlangt. Daher der Abschluss der Wissenschaft der Logik mit „der sich ‚‘frei entladenden‚‘ Idee“ in „Objektivität und äußeres Leben“ - und damit auch der systematische Übergang zur Realphilosophie.
Philosophie des Realen

Im Gegensatz zum ersten, logischen Teil von Hegels System ist der zweite, realphilosophische Teil - die Philosophie der Natur und des Geistes - ein fortlaufendes Projekt, das sich in seinem historischen Gehalt ständig verändert und weiterentwickelt. So sieht Hegel zwar „die Grundstruktur“ der Naturphilosophie als abgeschlossen an, ist sich aber „bewusst, dass die Wissenschaft nicht ‚fertig‘ ist und weiterhin neue Entdeckungen machen wird“. Die Philosophie ist, wie Hegel es ausdrückt, „‚ihre eigene Zeit, die in Gedanken erfasst ist‘“.
Er führt diese Definition weiter aus:
Noch ein Wort zum Thema Anweisung, wie die Welt zu sein hat: die Philosophie kommt jedenfalls immer zu spät, um diese Funktion zu erfüllen. Als Gedanke der Welt tritt sie erst dann auf, wenn die Wirklichkeit ihren Entstehungsprozeß durchlaufen hat und sich fertig gemacht hat. Diese Lehre des Begriffs ist notwendigerweise auch aus der Geschichte ersichtlich, dass nämlich erst dann, wenn die Wirklichkeit zur Reife gelangt ist, das Ideale dem Realen gegenübertritt und diese reale Welt, die es in ihrer Substanz erfasst hat, in der Gestalt eines geistigen Reiches rekonstruiert. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, ist eine Lebensform alt geworden, und sie kann durch das Grau in Grau der Philosophie nicht verjüngt, sondern nur erkannt werden; die Eule der Minerva beginnt ihren Flug erst mit Einbruch der Dämmerung.
Dies wurde häufig als Ausdruck der Ohnmacht der Philosophie, ob politisch oder nicht, und als Rationalisierung des Status quo gelesen. Allegra de Laurentiis weist jedoch darauf hin, dass der deutsche Ausdruck „‚‘sich fertig machen‚‘“ nicht nur die Vollendung, sondern auch die Vorbereitung impliziert. Diese zusätzliche Bedeutung ist wichtig, weil sie Hegels aristotelischen Begriff der Aktualität besser widerspiegelt. Er charakterisiert die Aktualität als ein An-sich-sein, das niemals ein für allemal vollendet oder abgeschlossen werden kann.
Das Verhältnis zwischen dem logischen und dem real-philosophischen Teil seines Systems beschreibt Hegel so: „Wenn die Philosophie inhaltlich nicht über ihrer Zeit steht, so tut sie es in der Form, weil sie als das Denken und Wissen dessen, was der wesentliche Geist ihrer Zeit ist, diesen Geist zu ihrem Gegenstand macht.“
Das heißt, was die Philosophie des Realen im technischen Sinne Hegels wissenschaftlich macht, ist die systematisch zusammenhängende logische Form, die sie in ihrem naturgeschichtlichen Material aufdeckt - und damit auch in ihrer Darstellung zeigt.
Die Naturphilosophie
Die Naturphilosophie ordnet das kontingente Material der Naturwissenschaften systematisch. Als Teil der Philosophie des Realen maßt sie sich keineswegs an, „der Natur zu sagen, wie sie zu sein hat.“ In der Geschichte haben verschiedene Interpreten Hegels Verständnis der Naturwissenschaften seiner Zeit in Frage gestellt. Diese Behauptung ist jedoch von der neueren Forschung weitgehend widerlegt worden.
Eine der wenigen Möglichkeiten, wie die Naturphilosophie die Behauptungen der Naturwissenschaften selbst korrigieren könnte, besteht darin, reduktive Erklärungen zu bekämpfen, d. h. Erklärungen zu diskreditieren, die Kategorien verwenden, die der Komplexität der Phänomene, die sie zu erklären vorgeben, nicht gerecht werden, wie z. B. der Versuch, das Leben mit rein chemischen Begriffen zu erklären.
Obwohl Hegel und andere „Naturphilosophen“ ein teleologisches Verständnis der Natur wiederbeleben wollen, argumentieren sie, dass ihr streng „internes“ oder „immanentes“ Konzept der Teleologie „auf die in der Natur selbst beobachtbaren Ziele beschränkt ist“. Daher, so behaupten sie, verstößt es nicht gegen die kantische Kritik. Noch stärker behaupten Hegel und Schelling, dass Kants Beschränkung der Teleologie auf einen regulativen Status sein eigenes kritisches Projekt, die Möglichkeit der Erkenntnis zu erklären, effektiv untergräbt. Ihr Argument lautet: „Nur unter der Voraussetzung, dass es einen Organismus gibt, ist es möglich, die ‚eigentliche Wechselwirkung‘ zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven, dem Idealen und dem Realen zu erklären.“ Dem Organismus muss also ein konstitutiver Status zuerkannt werden.
In einer Einführung in Hegels Naturphilosophie für ein Publikum des 21. Jahrhunderts stellt Dieter Wandschneider fest, dass die „zeitgenössische Wissenschaftsphilosophie“ „das ontologische Problem, um das es geht, nämlich die Frage nach einer inhärent gesetzmäßigen Natur“ aus den Augen verloren hat: „Betrachten wir zum Beispiel das Problem, was ein Naturgesetz ist. Dieses Problem ist für unser Verständnis der Natur von zentraler Bedeutung. Dennoch hat die Wissenschaftsphilosophie bis heute keine endgültige Antwort darauf gegeben. Eine solche Antwort können wir von ihr auch in Zukunft nicht erwarten.“ Wandschneider wendet sich an Hegel, um den Wissenschaftsphilosophen eine Orientierung in der Naturphilosophie zu geben.
In jüngster Zeit haben Wissenschaftler auch argumentiert, dass Hegels Ansatz der Naturphilosophie wertvolle Ressourcen für die Theoriebildung und die Bewältigung aktueller umweltpolitischer Herausforderungen bietet, die von Hegel nicht vorhergesehen wurden. Diese Philosophen verweisen auf solche Aspekte seiner Philosophie wie ihre ausgeprägte metaphysische Grundlegung und die Kontinuität ihres Konzepts der Natur-Geist-Beziehung.
Die Philosophie des Geistes

Der deutsche Begriff Geist hat eine breite Palette von Bedeutungen. In seiner allgemeinsten hegelschen Bedeutung bezeichnet Geist jedoch den menschlichen Geist und seine Produkte, im Gegensatz zur Natur und auch zur logischen Idee.“ (Einige ältere Übersetzungen geben ihn als „Geist“ und nicht als „Verstand“ wieder.)
Wie besonders in der Anthropologie deutlich wird, ist Hegels Begriff des Geistes eine Aneignung und Transformation des selbstreferentiellen aristotelischen Begriffs der energeia. Geist ist nicht etwas, das über der Natur steht oder ihr sonstwie äußerlich ist. Er ist „die höchste Organisation und Entwicklung“ der Kräfte der Natur.
Nach Hegel ist „das ‚‘Wesen‚‘ des Geistes die ‚‘Freiheit‚‘“. Die „Enzyklopädie“ Philosophie des Geistes zeichnet die progressiv bestimmten Stufen dieser Freiheit auf, bis der Geist den delphischen Imperativ erfüllt, mit dem Hegel beginnt: „'Erkenne dich selbst'“.
Wie deutlich wird, ist Hegels Freiheitsbegriff nicht (oder nicht nur) die Fähigkeit zur willkürlichen Wahl, sondern hat als „Kerngedanken“, dass „etwas, insbesondere eine Person, dann und nur dann frei ist, wenn sie unabhängig und selbstbestimmend ist, nicht von etwas anderem als sich selbst bestimmt oder abhängig.“ Mit anderen Worten: Es ist (zumindest überwiegend, dialektisch) eine Darstellung dessen, was Isaiah Berlin später als positive Freiheit bezeichnen würde.
Subjektiver Geist
Am Übergang von der Natur zum Geist besteht die Aufgabe der Philosophie des subjektiven Geistes darin, „die Elemente zu analysieren, die für solche Beziehungen [des objektiven Geistes] notwendig sind oder von ihnen vorausgesetzt werden, nämlich die Strukturen, die für den einzelnen rationalen Akteur charakteristisch und notwendig sind.“ Sie tut dies, indem sie „die grundlegende Natur des biologisch-geistigen menschlichen Individuums zusammen mit den kognitiven und praktischen Voraussetzungen der menschlichen sozialen Interaktion“ herausarbeitet.
Dieser Abschnitt, insbesondere sein erster Teil, enthält verschiedene Bemerkungen, die zu Hegels Zeiten gang und gäbe waren und heute als offen rassistisch erkannt werden können, wie z. B. unbegründete Behauptungen über die „von Natur aus“ geringere intellektuelle und emotionale Entwicklung von Schwarzen Menschen. Seiner Ansicht nach hängen diese Rassenunterschiede mit dem „Klima“ zusammen: Hegel zufolge sind es nicht die rassischen Merkmale, sondern die klimatischen Bedingungen, unter denen ein Volk lebt, die seine Fähigkeit zur freien Selbstbestimmung auf unterschiedliche Weise einschränken oder ermöglichen. Ethnie ist für ihn kein Schicksal: Jede Gruppe könnte im Prinzip ihre Lage verbessern und verändern, indem sie in freundlichere Gefilde auswandert.
Hegel unterteilt seine Philosophie des subjektiven Geistes in drei Teile: Anthropologie, Phänomenologie und Psychologie. Die Anthropologie „befasst sich mit der ‚Seele‘, die ein noch in der Natur befindlicher Geist ist: all das, was in uns ist und unserem selbstbewussten Verstand oder Intellekt vorausgeht.“ Im Abschnitt „Phänomenologie“ untersucht Hegel die Beziehung zwischen dem Bewusstsein und seinem Objekt und die Entstehung der intersubjektiven Rationalität. Die Psychologie „beschäftigt sich mit vielem, was man heute als Erkenntnistheorie bezeichnen würde. Hegel erörtert unter anderem die Natur der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der Einbildungskraft und der Urteilskraft.“
In diesem Abschnitt, vor allem aber in der Anthropologie, übernimmt und entwickelt Hegel Aristoteles' hylomorphen Ansatz zu dem, was heute als Leib-Seele-Problem bezeichnet wird: „Die Lösung des Leib-Seele-Problems [nach dieser Theorie] hängt von der Erkenntnis ab, dass der Geist nicht als Ursache von Wirkungen auf den Körper einwirkt, sondern vielmehr als verkörperte lebende Subjektivität auf sich selbst einwirkt. Als solcher entwickelt sich der Geist selbst und erlangt nach und nach immer mehr einen selbstbestimmten Charakter“.
Der letzte Abschnitt, Freier Geist, entwickelt den Begriff des „freien Willens“, der für Hegels Rechtsphilosophie grundlegend ist.
Objektiver Geist

Im weitesten Sinne ist Hegels Philosophie des objektiven Geistes „seine Sozialphilosophie, seine Philosophie darüber, wie sich der menschliche Geist in seinen sozialen und geschichtlichen Tätigkeiten und Produktionen vergegenständlicht.“ Oder anders ausgedrückt, sie ist eine Darstellung der Institutionalisierung der Freiheit. Besier erklärt dies zu einem seltenen Fall von Einmütigkeit in der Hegel-Forschung: „Alle Gelehrten sind sich einig, dass es in Hegels politischer Theorie keinen wichtigeren Begriff gibt als die Freiheit.“ Denn sie ist die Grundlage des Rechts, die Essenz des Geistes und das „Telos“ der Geschichte.
Dieser Teil von Hegels Philosophie wird zunächst in seiner „Enzyklopädie“ von 1817 (überarbeitet 1827 und 1830) und dann ausführlicher in den „Elementen der Rechtsphilosophie oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Umriss“ von 1821 (wie die „Enzyklopädie“ als Lehrbuch gedacht) dargestellt, über die er auch häufig Vorlesungen hielt. Ihr letzter Teil, die Philosophie der Weltgeschichte, wurde zusätzlich in Hegels Vorlesungen zu diesem Thema ausgearbeitet.
Hegels Elemente der Rechtsphilosophie sind seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung umstritten. Es handelt sich jedoch nicht um eine reine Verteidigung des autokratischen preußischen Staates, wie manche behauptet haben, sondern vielmehr um eine Verteidigung des „Preußens, wie es unter [vorgeschlagenen] Reformverwaltungen hätte werden sollen“.
Das deutsche Recht in Hegels Titel hat keine direkte englische Entsprechung (obwohl es dem lateinischen „ius“ und dem französischen „droit“ entspricht). In einer ersten Annäherung unterscheidet Michael Inwood drei Bedeutungen:
- ein Recht, Anspruch oder Titel
- Gerechtigkeit (wie z.B. in 'Recht sprechen'...aber nicht Gerechtigkeit als Tugend...)
- 'das Gesetz' als Prinzip, oder 'die Gesetze' insgesamt.
Beiser bemerkt, dass Hegels Theorie „sein Versuch ist, die Naturrechtstradition zu rehabilitieren und dabei die Kritik der historischen Schule zu berücksichtigen“. Er fügt hinzu, dass „wir ohne eine solide Interpretation von Hegels Naturrechtstheorie nur sehr wenig von der Grundlage seines sozialen und politischen Denkens verstehen.“ In Übereinstimmung mit Beisers Position dokumentiert Adriaan T. Peperzak Hegels Argumente gegen die Gesellschaftsvertragstheorie und betont die metaphysischen Grundlagen von Hegels Rechtsphilosophie.
Kenneth R. Westphal stellt fest, dass „die Analyse der Struktur von Hegels Argumentation in der ‚Philosophie des Rechts‘ zeigt, dass das Erreichen politischer Autonomie für Hegels Analyse des Staates und der Regierung von grundlegender Bedeutung ist“, und gibt diesen kurzen Überblick:
- "'Abstraktes Recht,' behandelt Prinzipien, die das Eigentum, seine Übertragung und das Unrecht am Eigentum regeln.“
- "'Moral,' behandelt die Rechte moralischer Subjekte, die Verantwortung für die eigenen Handlungen und a priori Theorien des Rechts.“
- "'Ethisches Leben' (Sittlichkeit), analysiert die Prinzipien und Institutionen, die zentrale Aspekte des rationalen sozialen Lebens regeln, einschließlich der Familie, der Zivilgesellschaft und des Staates als Ganzes, einschließlich der Regierung.“
Hegel beschreibt den Staat seiner Zeit, eine konstitutionelle Monarchie, als rationale Verkörperung von drei kooperativen und sich gegenseitig einschließenden Elementen. Diese Elemente sind „die Demokratie (Herrschaft der Vielen, die an der Gesetzgebung beteiligt sind), die Aristokratie (Herrschaft der Wenigen, die die Gesetze anwenden, konkretisieren und ausführen) und die Monarchie (Herrschaft des Einen, der an der Spitze steht und die ganze Macht umfasst)“. Aristoteles nannte sie eine „gemischte“ Regierungsform, die das Beste aus jeder der drei klassischen Formen in sich vereint. Die Teilung der Gewalten „verhindert, dass eine einzelne Macht die anderen beherrscht“. Hegel ist besonders darauf bedacht, den Monarchen an die Verfassung zu binden und seine Autorität so einzuschränken, dass er kaum mehr tun kann, als das zu verkünden, was seine Minister bereits beschlossen haben, dass es so sein soll.
Das Verhältnis von Hegels Rechtsphilosophie zum modernen Liberalismus ist komplex. Er sieht den Liberalismus als einen wertvollen und charakteristischen Ausdruck der modernen Welt. Er birgt jedoch die Gefahr in sich, seine eigenen Werte zu untergraben. Diese selbstzerstörerische Tendenz kann vermieden werden, indem man „die subjektiven Ziele des Einzelnen an einem größeren objektiven und kollektiven Gut“ misst. Moralische Werte haben also nur einen „begrenzten Platz im Gesamtgefüge der Dinge“. Doch obwohl Hegel nicht ohne Grund weithin als ein Hauptvertreter dessen gilt, was Isaiah Berlin später als positive Freiheit bezeichnen würde, war er in seiner Verteidigung der negativen Freiheit ebenso „unerschütterlich und eindeutig“.
So wie Hegels idealer Souverän viel schwächer ist, als es für die Monarchien seiner Zeit typisch war, so ist auch sein demokratisches Element viel schwächer, als es für die Demokratien der modernen Zeit typisch ist. Obwohl er auf der Bedeutung der Bürgerbeteiligung besteht, schränkt Hegel das Wahlrecht stark ein und folgt dem englischen Zweikammermodell, bei dem nur die Mitglieder des Unterhauses, also die Bürgerlichen und die Bourgeoisie, gewählt werden. Die Adligen im Oberhaus erben ihr Amt, ebenso wie der Monarch.
Der letzte Teil der Philosophie des objektiven Geistes trägt den Titel „Weltgeschichte“. In diesem Abschnitt argumentiert Hegel, dass „dieses immanente Prinzip [der stoische ‚logos‘] mit logischer Zwangsläufigkeit eine Erweiterung der Fähigkeiten der Gattung zur Selbstbestimmung (‚Freiheit‘) und eine Vertiefung ihres Selbstverständnisses (‚Selbsterkenntnis‘) hervorbringt.“ In Hegels eigenen Worten: „Die Weltgeschichte ist ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit - ein Fortschritt, den wir begrifflich begreifen müssen.“
(Siehe auch: Vermächtnis, unten, für eine weitere Diskussion des komplexen Vermächtnisses von Hegels sozialer und politischer Philosophie.)
Absoluter Geist

(1828 sketch by F. T. Kugler)
Hegels Verwendung des Begriffs „absolut“ wird leicht missverstanden. Inwood klärt jedoch auf: abgeleitet vom lateinischen „absolutus“ bedeutet er „nicht abhängig, bedingt, relativ zu oder eingeschränkt durch etwas anderes; in sich geschlossen, vollkommen, vollständig“. Für Hegel bedeutet dies, dass absolutes Wissen nur „ein ‚absolutes Verhältnis‘ bezeichnen kann, in dem der Grund der Erfahrung und das erfahrende Agens ein und dasselbe sind: das erkannte Objekt ist ausdrücklich das Subjekt, das weiß.“ Das heißt, das einzige „Ding“ (das in Wirklichkeit eine Tätigkeit ist), das wirklich absolut ist, ist das, was sich vollständig selbst bedingt, und dies geschieht nach Hegel nur, wenn der Geist sich selbst als sein eigenes Objekt aufnimmt. Der letzte Abschnitt seiner Philosophie des Geistes stellt die drei Modi eines solchen absoluten Wissens vor: Kunst, Religion und Philosophie.
Hegel unterscheidet die drei Modalitäten des absoluten Wissens anhand der verschiedenen Modalitäten des Bewusstseins - Intuition, Vorstellung und begreifendes Denken. Frederick Beiser fasst zusammen: „Kunst, Religion und Philosophie haben alle denselben Gegenstand, das Absolute oder die Wahrheit selbst; aber sie bestehen in verschiedenen Formen der Erkenntnis desselben. Die Kunst präsentiert das Absolute in der Form der unmittelbaren Anschauung, die Religion in der Form der Vorstellung und die Philosophie in der Form der Begriffe.“
Rüdiger Bubner stellt darüber hinaus klar, dass die Steigerung der begrifflichen Transparenz, nach der diese Sphären systematisch geordnet werden, in keinem wertenden Sinne hierarchisch ist.
Obwohl Hegels Diskussion des absoluten Geistes in der Enzyklopädie recht kurz ist, entwickelt er seine Darstellung ausführlich in Vorlesungen zur Philosophie der bildenden Kunst, zur Religionsphilosophie und zur Geschichte der Philosophie.
Philosophie der Kunst

In der Phänomenologie und auch in der Ausgabe der Enzyklopädie von 1817 behandelt Hegel die Kunst nur im Rahmen dessen, was er als die „Kunst-Religion“ der alten Griechen bezeichnet. Im Jahr 1818 beginnt Hegel jedoch, über die Philosophie der Kunst als ausdrücklich autonomen Bereich zu referieren.
Obwohl H. G. Hotho seine Ausgabe der Vorlesungen mit „Vorlesungen über die Ästhetik“ betitelt hat, sagt Hegel direkt, dass sein Thema nicht „das weite Reich des Schönen“, sondern „die Kunst, oder vielmehr die schöne Kunst“ ist. Im nächsten Absatz unterstreicht er dies noch einmal, indem er sein Projekt ausdrücklich von den umfassenderen philosophischen Projekten unterscheidet, die von Christian Wolff und Alexander Gottlieb Baumgarten unter der Überschrift „Ästhetik“ verfolgt wurden.
Einige Kritiker - allen voran Benedetto Croce im Jahr 1907 - haben Hegel eine Form der These zugeschrieben, dass die Kunst „tot“ sei. Hegel hat jedoch nie etwas Derartiges gesagt, noch kann ihm eine solche Ansicht plausibel zugeschrieben werden. Tatsächlich relativiert ein Kommentator diese Debatte mit der Bemerkung, dass Hegels Behauptung, dass „die Kunst nicht mehr unseren höchsten Zielen dient“, „nicht wegen der Behauptung radikal ist, dass die Kunst dies jetzt nicht mehr tut, sondern wegen der Behauptung, dass sie es jemals tat“.
Hegels detaillierte und systematische Behandlung der verschiedenen Künste über einen so großen Zeitraum hat Ernst Gombrich sogar dazu veranlasst, Hegel als „Vater der Kunstgeschichte“ zu bezeichnen. In der Tat wurden [when?] Hegels „Vorlesungen“ bis vor kurzem von Philosophen weitgehend ignoriert und erhielten die meiste Aufmerksamkeit von Literaturkritikern und Kunsthistorikern.
Das enger gefasste konzeptionelle Projekt der Kunstphilosophie besteht jedoch darin, „die ‚Autonomie‘ der Kunst zu artikulieren und zu verteidigen, indem sie eine Erklärung für die ‚besondere Individualität‘ ermöglicht, die Werke von ästhetischem Wert auszeichnet.“
Nach Hegel enthüllt "'künstlerische Schönheit die absolute Wahrheit durch die Wahrnehmung.' Er ist der Meinung, dass die beste Kunst metaphysisches Wissen vermittelt, indem sie durch die Sinneswahrnehmung das offenbart, was unbedingt wahr ist“, d.h. “was seine metaphysische Theorie als unbedingte oder absolute Wahrheit behauptet.“ Während Hegel also „die Kunst insofern adelt, als sie metaphysisches Wissen vermittelt“, „mildert er sein Urteil angesichts seiner Überzeugung, dass die Sinnesmedien der Kunst niemals angemessen das vermitteln können, was die Kontingenz der Empfindung völlig transzendiert“. Deshalb kann die Kunst nach Hegel nur eine von drei sich gegenseitig ergänzenden Formen des absoluten Geistes sein.
Christentum
Obwohl sich sein Verständnis des Christentums im Laufe der Zeit veränderte, bekannte sich Hegel sein ganzes Leben lang zum Luthertum. Eine Konstante war seine tiefe Wertschätzung für die christliche Einsicht in den Eigenwert und die Freiheit eines jeden Menschen.
Frühromantische Schriften
Hegels früheste Schriften zum Christentum stammen aus den Jahren 1783 bis 1800. Zu dieser Zeit war er noch dabei, seine Ideen auszuarbeiten, und alles aus dieser Zeit wurde als Fragmente oder unfertige Entwürfe aufgegeben. Hegel war sehr unzufrieden mit dem Dogmatismus und der Positivität der christlichen Religion, der er die spontane Religion der Griechen gegenüberstellte. In „Der Geist des Christentums“ schlägt er eine Art Lösung vor, indem er die Universalität der kantischen Moralphilosophie mit der Universalität der Lehren Jesu in Einklang bringt: „Das moralische Prinzip des Evangeliums ist die Nächstenliebe oder die Liebe, und die Liebe ist die Schönheit des Herzens, eine geistige Schönheit, die die griechische Seele und Kants moralische Vernunft vereint.“ Obwohl er nicht zu dieser romantischen Formulierung zurückkehrte, sollte die Vereinigung von griechischem und christlichem Denken sein ganzes Leben lang ein Anliegen bleiben.
Die Phänomenologie des Geistes
Die Religion zieht sich als Hauptthema durch die Phänomenologie des Geistes von 1807, lange bevor sie als explizites Thema des vorletzten Religionskapitels auftaucht. Dies zeigt sich am unmittelbarsten in der metaphysischen „Unzufriedenheit“ des augustinischen Bewusstseins in Kapitel IV und in Hegels Darstellung des Kampfes der Kirche der Gläubigen mit den Philosophen der Aufklärung in Kapitel VI.
Hegels eigentliche Darstellung des Christentums findet sich jedoch im letzten Abschnitt der „Phänomenologie“, unmittelbar vor dem Schlusskapitel „Absolutes Wissen“. Sie wird unter der Überschrift „Die offenbare Religion“ dargestellt. Mittels philosophischer Darlegung christlicher Lehren wie Inkarnation und Auferstehung erhebt Hegel den Anspruch, die begriffliche Wahrheit des Christentums zu demonstrieren bzw. „offenkundig“ zu machen und so das nur positiv Geoffenbarte durch die Explikation der ihm zugrunde liegenden Offenbarungswahrheit zu überwinden.
Der Kern von Hegels Interpretation des Christentums zeigt sich in seiner Interpretation der Trinität. Gott der Vater muss sich selbst als endlich menschlicher Sohn geben, dessen Tod sein wesentliches Wesen als Geist offenbart - und, entscheidend, nach Hegel, macht sein [Hegels] eigener philosophischer Begriff des Geistes transparent, was im christlichen Konzept der Trinität nur undeutlich dargestellt ist. Und so macht er die philosophische Wahrheit der Religion offenbar, die nun bekannt ist.
In einem Aufsatz über die „Phänomenologie“ stellt George di Giovanni Kants rationalen Glauben der rationalen Religion Hegels gegenüber. Seiner Ansicht nach besteht die moderne Rolle der Religion eher darin, „den Geist in seinen individuellsten Formen auszudrücken und zu nähren“, als die Realität zu erklären. Es gibt keinen Platz mehr für den Glauben im Gegensatz zum Wissen. Stattdessen nimmt der Glaube Formen an wie das Vertrauen „in uns nahestehende Personen oder in die Zeit und den Ort, in denen wir zufällig leben“.
Mit anderen Worten: Nach Hegels philosophischer Interpretation verlangt das Christentum keinen Glauben an eine Lehre, die nicht vollständig durch die Vernunft begründet ist. Was also bleibt, ist die Religionsgemeinschaft, die frei ist, den individuellen Bedürfnissen zu dienen und die absolute Freiheit des Geistes zu feiern.
Die Berliner Vorlesungen
Hegels Enzyklopädie enthält einen Abschnitt über die Offenbarungsreligion, der jedoch recht kurz ist. In seinen Berliner Vorlesungen findet sich die nächste Darstellung des Christentums, das er als „vollendete“, „absolute“ oder „offenbarende“ Religion bezeichnet (alles gleichbedeutende Begriffe in diesem Zusammenhang). Von drei der vier Vorlesungen Hegels sind Abschriften erhalten, die zeigen, dass er seine Schwerpunkte und Darstellungen ständig anpasst. Die Interpretation des Christentums, die er vertritt, ist jedoch immer noch weitgehend diejenige, die er in der Phänomenologie dargelegt hat - nur ist er jetzt in der Lage, das, was er zuvor in so komprimierter Form behandelt hatte, ausführlicher und klarer zu erläutern.
Fragen der Interpretation

Walter Jaeschke fragt, ob Luther Hegels Anspruch auf den Protestantismus anerkannt hätte. Hegel übernimmt mit seinem Begriff des Geistes die Lehre vom Priestertum aller Gläubigen, lehnt aber die lutherischen Kernlehren sola gratia und sola scriptura ab. Stattdessen bekräftigt er als „Grundprinzip“ des Protestantismus „den Eigensinn, der der Menschheit zur Ehre gereicht, sich zu weigern, irgendetwas in der Überzeugung anzuerkennen, was nicht durch das Denken bestätigt wird“. Aus ähnlichen Gründen beschreibt Friedrich Beiser, obwohl er Hegels scheinbar aufrichtiges Bekenntnis zum Luthertum anerkennt, Hegels Theologie als „das genaue Gegenteil von Luthers“.
Bei der Erörterung der „Hegel-Renaissance“ in der anglo-amerikanischen Philosophie des späten 20. Jahrhunderts zeigt sich Beiser - angesichts der heutigen hochgradig säkularen akademischen Kultur - überrascht von einem solchen Anstieg des Interesses an Hegel. Denn nach Hegel ist das Göttliche der Mittelpunkt der Philosophie. Hegels Gottesbegriff unterscheidet sich von den theistischen Vorstellungen des orthodoxen Christentums und von den deistischen Vorstellungen der Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts. Jahrhunderts vorschlugen. Nichtsdestotrotz fasst Hegel Gott als das Unendliche oder Absolute auf, in Übereinstimmung mit der klassischen Definition des heiligen Anselm als „das, wovon nichts Größeres erdacht werden kann“.
Die Frage, wie Hegels charakteristische Formulierung des Christentums am besten zu charakterisieren ist, war schon zu seinen Lebzeiten und unter seinen Schülern nach seinem Tod Gegenstand intensiver Debatten. Und so wird es wahrscheinlich auch bleiben. Hegels Gott ist weder theistisch noch deistisch und kann nur mit den philosophischen Begriffen des Geistes oder seinem eigenen logischen Vokabular ausgedrückt werden. Dennoch beharrt Hegel überall darauf, dass er der christliche Gott ist.
Philosophie der Geschichte
„Die Geschichte“, schreibt Friedrich Beiser, “ist für Hegels Auffassung von Philosophie von zentraler Bedeutung.“ Philosophie ist nur möglich, „wenn sie historisch ist, nur wenn der Philosoph sich der Ursprünge, des Kontextes und der Entwicklung seiner Lehren bewusst ist.“ In diesem Aufsatz von 1993 mit dem Titel „Hegels Historismus“ erklärt Beiser dies zu „nichts weniger als einer Revolution in der Geschichte der Philosophie“. In einer Monographie aus dem Jahr 2011 schließt Beiser Hegel jedoch aus seiner Behandlung der deutschen historistischen Tradition aus, weil Hegel mehr an der Geschichtsphilosophie als an dem erkenntnistheoretischen Projekt der Rechtfertigung ihres Status als Wissenschaft interessiert ist. Gegen die relativistischen Implikationen des Historismus im engeren Sinne liefert Hegels Metaphysik des Geistes ein der Geschichte selbst innewohnendes „Telos“, an dem der Fortschritt gemessen und beurteilt werden kann. Dies ist das Selbstbewusstsein der Freiheit. Je mehr das Bewusstsein dieser wesentlichen Freiheit des Geistes eine Kultur durchdringt, desto fortschrittlicher ist sie nach Hegel.
Da die Freiheit nach Hegel das Wesen des Geistes ist, ist die Entwicklung des Selbstbewusstseins darüber ebenso eine Entwicklung in der Wahrheit wie im politischen Leben. Das Denken setzt einen „instinktiven Glauben“ an die Wahrheit voraus, und die Geschichte der Philosophie, wie sie von Hegel erzählt wird, ist eine fortschreitende Abfolge von „systemidentischen“ Wahrheitsbegriffen.
Ob Hegel ein Historiker ist oder nicht, hängt davon ab, wie man den Begriff definiert. Die Bedeutung der Geschichte in Hegels Philosophie lässt sich jedoch nicht leugnen.
Im Deutschen gibt es zwei Wörter für „Geschichte“, Historie und Geschichte. Das erste bezieht sich auf „die narrative Organisation des empirischen Materials“. Das zweite „beinhaltet eine Darstellung der zugrundeliegenden Entwicklungslogik (des ‚inneren Grundes‘) von Taten und Ereignissen.“ Nur das letztere Verfahren kann eine wirklich universelle oder philosophische Geschichte liefern, und dieses Verfahren wendet Hegel in allen seinen historischen Schriften an. Nach Hegel ist der Mensch ein ausgesprochen geschichtliches Wesen, weil er nicht nur in der Zeit existiert, sondern auch die zeitlichen Ereignisse verinnerlicht, so dass sie in einem tiefen Sinn Teil dessen werden, was und wer der Mensch ist, „ein integraler Bestandteil des Selbstverständnisses und der Selbsterkenntnis der Menschheit“. Aus diesem Grund ist zum Beispiel die Geschichte der Philosophie ein integraler Bestandteil der Philosophie selbst, da es für die frühen Philosophen buchstäblich unmöglich war, das zu denken, was spätere Philosophen, denen der ganze Reichtum ihrer Vorgänger zur Verfügung stand, denken konnten - und mit diesem Abstand vielleicht auch gründlicher oder konsequenter durcharbeiten konnten. Aus einer späteren Perspektive wird zum Beispiel deutlich, dass der Begriff des Personseins die Implikation der Universalität beinhaltet, so dass jede Interpretation oder Umsetzung, die ihn auf einige Menschen ausdehnt, aber nicht auf andere, widersprüchlich ist.
In der Einleitung zu seinen „Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte“ unterteilt Hegel die Menschheitsgeschichte in drei Epochen, wobei er seine eigene Darstellung vereinfacht. In der „orientalischen“ Welt, wie er sie nennt, war „eine“ Person (der Pharao oder Kaiser) frei. In der griechisch-römischen Welt waren „einige“ Menschen (wohlhabende Bürger) frei. In der „germanischen“ Welt (d. h. im europäischen Christentum) sind „alle“ Menschen frei.
In seiner Erörterung der antiken Welt verteidigt Hegel die Sklaverei mit starken Einschränkungen. Wie er an anderer Stelle sagt, „tritt die Sklaverei in einer Übergangsphase zwischen dem natürlichen menschlichen Dasein und dem wahrhaft ethischen Zustand auf; sie tritt in einer Welt auf, in der ein Unrecht noch Recht ist. Hier ist das Unrecht 'gültig', so dass die Stellung, die es einnimmt, eine notwendige ist.“ Hegel ist sich jedoch darüber im Klaren, dass es eine unbedingte moralische Forderung gibt, die Institution der Sklaverei abzulehnen, und dass die Sklaverei unvereinbar ist mit dem rationalen Staat und der essentiellen Freiheit eines jeden Individuums.
Einige Kommentatoren - vor allem Alexandre Kojève und Francis Fukuyama - haben Hegel so verstanden, dass die Geschichte mit dem Erreichen eines vollständig universellen Freiheitsbegriffs abgeschlossen ist, dass sie ihr Ende erreicht hat. Dagegen lässt sich jedoch einwenden, dass die Freiheit sowohl in Bezug auf ihren Umfang als auch auf ihren Inhalt noch erweitert werden kann. Seit Hegels Zeiten ist der Umfang des Freiheitsbegriffs erweitert worden, um die rechtmäßige Einbeziehung von Frauen, ehemals versklavten oder kolonisierten Völkern, Geisteskranken und Menschen, die nicht den konservativen Normen in Bezug auf sexuelle Präferenzen oder Geschlechtsidentität entsprechen, anzuerkennen, um nur einige zu nennen. Was den Inhalt der Freiheit anbelangt, so erweitert beispielsweise die Internationale Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen den Begriff der Freiheit über das hinaus, was Hegel selbst formuliert hat. Obwohl Hegel seine philosophischen Geschichten durchweg als Ost-West-Erzählungen darstellt, argumentieren Wissenschaftler wie J. M. Fritzman, dass dieses Vorurteil nicht nur für die Substanz von Hegels philosophischer Position völlig nebensächlich ist, sondern dass - mit Indien, das heute die größte Demokratie der Welt ist, oder mit Südafrikas gewaltigen Bemühungen, die Apartheid zu überwinden - die Bewegung der Freiheit zurück in den Osten vielleicht schon begonnen hat.
Dialektik, Spekulation, Idealismus
Hegel wird oft nachgesagt, dass er nach einer „dialektischen Methode“ vorgehe; tatsächlich aber charakterisiert Hegel seine Philosophie als „spekulativ“ (spekulativ), nicht als dialektisch, und verwendet den Begriff „dialektisch“ nur „ganz selten“. Denn obwohl „‚‘Dialektik‚‘ manchmal für die ganze Bewegung der Selbstartikulation des Sinns oder des Denkens steht, bezieht sich dieser Begriff doch spezifischer auf die Selbstverneinung der Bestimmungen des Verstandes, wenn sie in ihrer Festigkeit und ihrem Gegensatz durchdacht werden.“
Demgegenüber „beschreibt Hegel das richtige Denken als das methodische Zusammenspiel von drei Momenten[:]
- (a) abstrakt und intellektuell (verständig),
- (b) dialektisch oder negativ rational (negativvernünftig), und
- (c) spekulativ oder positivvernünftig.
Zum Beispiel ist das Selbstbewusstsein „der Begriff, den das Bewusstsein von sich selbst hat“. In diesem Fall fallen also Begriff und Referent zusammen: ... 'Selbstbewußtsein' bezieht sich darauf, daß der Geist die selbstwidersprüchliche (und damit auch selbstverneinende) Rolle einnimmt, Subjekt und Objekt ein und desselben Erkenntnisaktes zu sein - gleichzeitig und in gleicher Hinsicht.“ Es handelt sich also um ein spekulatives Konzept.
Wenn Hegel überhaupt eine Methodologie hat, so Beiser, „so scheint sie eine Anti-Methodologie zu sein, eine Methode zur Aufhebung aller Methoden.“ Hegels Begriff „Dialektik“ muss in Bezug auf den „Begriff“ des Untersuchungsgegenstandes verstanden werden. Was es zu erfassen gilt, ist „die ‚Selbstorganisation‘ des Gegenstandes, seine ‚innere Notwendigkeit‘ und ‚Eigenbewegung‘“'" Hegel verzichtet auf alle äußeren Methoden, die auf einen Gegenstand „angewandt“ werden könnten.
Der dialektische Charakter von Hegels spekulativem Vorgehen macht es oft schwierig, seine Position zu einem bestimmten Thema zu charakterisieren. Anstatt zu versuchen, eine Frage zu beantworten oder ein Problem direkt zu lösen, formuliert er es häufig um, indem er zum Beispiel zeigt, „wie die dem Streit zugrunde liegende Dichotomie falsch ist und dass es daher möglich ist, Elemente beider Positionen zu integrieren.“ Das spekulative Denken bewahrt das Wahre aus scheinbar gegensätzlichen Theorien in einem Prozess, den Hegel „Sublation“ nennt.
Sublimieren“ (‚‘aufheben‚‘) hat drei Hauptbedeutungen:
- 'erheben, halten, aufheben';
- 'aufheben, abschaffen, zerstören, aufheben, aufheben'; und,
- 'bewahren, retten, erhalten'.
Hegel verwendet den Begriff im Allgemeinen in allen drei Bedeutungen, mit besonderer Betonung der zweiten und dritten, in denen scheinbare Widersprüche spekulativ überwunden werden. Sein Wort für das, was sublimiert wird, ist „das Moment“ (im Neutrum), das „ein wesentliches Merkmal oder einen Aspekt eines als statisches System gedachten Ganzen und eine wesentliche Phase in einem als dialektische Bewegung oder Prozess gedachten Ganzen“ bezeichnet. (Wenn Hegel etwas als „widersprüchlich“ bezeichnet, meint er damit, dass es sich nicht unabhängig aus sich selbst heraus trägt und daher nur als ein Moment eines größeren Ganzen begriffen werden kann).
Das Endliche als Moment des Ganzen und nicht als selbstbestimmtes Seiendes zu denken, bedeutet nach Hegel, es als idealisiert zu begreifen (das Ideelle). Idealismus ist also „die Lehre, dass endliche Entitäten ideal (‚‘ideell‚‘) sind: Sie hängen in ihrer Existenz nicht von sich selbst ab, sondern von einer größeren, sich selbst erhaltenden Einheit [d.h. dem Ganzen], die ihnen zugrunde liegt oder sie umfasst.“
Die Pronomenausdrücke - Moment, sublimieren und idealisieren - sind charakteristisch für Hegels Darstellung des Idealismus. Sie können als Stufen des Denkens verstanden werden, in denen der „Gegenstand zuerst in bloßer Andeutung, dann nach inneren und äußeren Umständen begrifflich vorhanden ist und endlich ganz für sich steht“. Diese phänomenologische und begriffliche Analyse unterscheidet Hegels Idealismus vom transzendentalen Idealismus Kants und dem mentalistischen Idealismus Berkeleys. Im Gegensatz zu diesen Positionen ist der Hegelsche Idealismus mit dem Realismus und dem nicht-mechanistischen Naturalismus durchaus vereinbar. Diese Position lehnt den Empirismus als eine apriorische Darstellung des Wissens ab, ist aber keineswegs gegen die philosophische Legitimität des empirischen Wissens. Hegels idealistische Behauptung, die er zu beweisen vorgibt, ist, dass das „Sein selbst“ rational ist.
Obwohl es nicht falsch ist, Hegels Philosophie als „absoluten Idealismus“ zu bezeichnen, wurde diese Bezeichnung zu jener Zeit eher mit Schelling in Verbindung gebracht, und Hegel selbst hat sie nachweislich nur dreimal in Bezug auf seine eigene Philosophie verwendet.
Nach Hegel ist „jede Philosophie wesentlich Idealismus“. Diese Behauptung beruht auf der Annahme, die Hegel zu beweisen vorgibt, dass die Begriffsbildung auf allen kognitiven Ebenen vorhanden ist. Denn dies gänzlich zu leugnen, würde das Vertrauen in die für objektive Erkenntnis notwendigen Begriffsfähigkeiten untergraben - und damit zum totalen Skeptizismus führen. Daher, so Robert Stern, läuft Hegels Idealismus „auf eine Form des ‚‘begrifflichen Realismus‚‘ hinaus, verstanden als 'die Überzeugung, dass Begriffe Teil der Struktur der Wirklichkeit sind.'"
Thesis-Antithesis-Synthesis
Diese weitgehend von Fichte entwickelte Terminologie wurde von Heinrich Moritz Chalybäus in inzwischen weitgehend diskreditierten Darstellungen der Hegelschen Philosophie verbreitet. Walter Kaufmann beispielsweise berichtet:
Fichte führte in die deutsche Philosophie den Dreischritt von These, Antithese und Synthese ein und verwendete diese drei Begriffe. Schelling griff diese Terminologie auf. Hegel nicht. Er hat diese drei Begriffe nicht ein einziges Mal zusammen verwendet, um drei Stufen in einem Argument oder einer Darstellung in irgendeinem seiner Bücher zu bezeichnen. Und sie helfen uns nicht, seine Phänomenologie, seine Logik oder seine Geschichtsphilosophie zu verstehen; sie erschweren jedes unvoreingenommene Verständnis dessen, was er tut, indem sie es in ein Schema zwingen, das ihm zur Verfügung stand und das er absichtlich verschmäht hat.
Bescheidener ausgedrückt, wurde gesagt, dass diese Darstellung „nur ein Teilverständnis ist, das der Korrektur bedarf“. Richtig ist, dass nach Hegel im Laufe der geschichtlichen Entwicklung „die Wahrheit aus dem Irrtum hervorgeht“, und zwar in einer Weise, die einen „Holismus impliziert, in dem Teilwahrheiten nach und nach korrigiert werden, so dass ihre Einseitigkeit überwunden wird“. Das verkennt, dass eine solche Beschreibung erst nach der Entfaltung des Prozesses möglich ist. Die „These“ und die „Antithese“ sind einander nicht „fremd“. Sofern man von einer solchen „dialektischen Methode“ sprechen kann, handelt es sich nicht um eine äußere Methode, die auf einen bestimmten Gegenstand „angewendet“ werden könnte.
In ähnlicher Weise argumentiert Stephen Houlgate, dass es sich bei Hegels „Methode“, in welchem begrenzten Sinne auch immer, um eine strikt „immanente“ Methode handelt, d.h. um eine Methode, die aus der gedanklichen Vertiefung in den Gegenstand selbst hervorgeht. Wenn dies zur Dialektik führt, dann nur, weil es einen Widerspruch im Gegenstand selbst gibt, nicht aufgrund eines äußeren methodischen Verfahrens.
Rezeption
Hegels Einfluss auf die nachfolgenden philosophischen Entwicklungen war enorm. Im England des späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts vertrat eine als britischer Idealismus bekannte Schule eine Version des absoluten Idealismus in direkter Auseinandersetzung mit Hegels Texten. Prominente Mitglieder waren J. M. E. McTaggart, R. G. Collingwood und G. R. G. Mure. Unabhängig davon haben einige Philosophen wie Marx, Dewey, Derrida, Adorno und Gadamer die Hegelschen Ideen selektiv in ihre eigenen philosophischen Programme aufgenommen. Andere haben ihre Positionen in Opposition zu Hegels System entwickelt. Dazu gehören zum Beispiel so unterschiedliche Philosophen wie Schopenhauer, Kierkegaard, Russell, G. E. Moore und Foucault. In der Theologie prägt der Einfluss Hegels das Werk von Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer. Diese Namen stellen jedoch nur einen kleinen Ausschnitt der wichtigeren Persönlichkeiten dar, die ihr Denken in Auseinandersetzung mit der Philosophie Hegels entwickelt haben.
„Rechter“ vs. „Linker“ Hegelianismus

Einige Historiker stellen den frühen Einfluss Hegels auf die germanische Philosophie als in zwei gegensätzliche Lager geteilt dar: rechts und links. Die Rechtshegelianer, die angeblich direkten Schüler Hegels an der Friedrich-Wilhelms-Universität, vertraten eine protestantische Orthodoxie und den politischen Konservatismus der Zeit nach der napoleonischen Restauration. Die Linkshegelianer, auch bekannt als die Junghegelianer, interpretierten Hegel in einem revolutionären Sinne, was zu einer Befürwortung des Atheismus in der Religion und der liberalen Demokratie in der Politik führte. Neuere Studien haben dieses Paradigma jedoch in Frage gestellt.
Die Rechtshegelianer „gerieten schnell in Vergessenheit“ und „sind heute hauptsächlich nur noch Spezialisten bekannt“; zu den Linkshegelianern hingegen „gehörten einige der wichtigsten Denker der Zeit“, und „durch ihre Betonung der Praxis sind einige dieser Denker äußerst einflussreich geblieben“, vor allem durch die marxistische Tradition.
Zu den ersten Anhängern, die sich ausdrücklich kritisch mit Hegels System auseinandersetzten, gehörte die deutsche Gruppe des 19. Jahrhunderts, die als Junghegelianer bekannt wurde und zu der Feuerbach, Marx, Engels und ihre Anhänger gehörten. Die Hauptaussage ihrer Kritik ist in der elften von Marx' „Thesen über Feuerbach“ aus seiner „Deutschen Ideologie“ von 1845 prägnant formuliert: „Die Philosophen haben die Welt nur auf verschiedene Weise ‚gedeutet‘; es kommt aber darauf an, sie zu ‚verändern‘.“
Im zwanzigsten Jahrhundert wurde eine hegelianisch geprägte Interpretation von Marx in den Arbeiten der kritischen Theoretiker der Frankfurter Schule weiterentwickelt. Dies war zurückzuführen auf (a) die Wiederentdeckung und Neubewertung Hegels als möglicher philosophischer Stammvater des Marxismus durch philosophisch orientierte Marxisten; (b) ein Wiederaufleben von Hegels historischer Perspektive; und (c) eine zunehmende Anerkennung der Bedeutung seiner dialektischen Methode. Insbesondere György Lukács' „Geschichte und Klassenbewusstsein“ (1923) trug dazu bei, dass Hegel wieder in den marxistischen Kanon aufgenommen wurde.
Rezeption in Frankreich
Es hat sich eingebürgert, den „französischen Hegel“ mit den Vorlesungen von Alexandre Kojève zu identifizieren, der die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft (die er fälschlicherweise als Herr und Sklave übersetzte) und Hegels Geschichtsphilosophie betonte. Diese Sichtweise übersieht jedoch mehr als sechzig Jahre französischer Schriften über Hegel, nach denen der Hegelianismus mit dem in der Enzyklopädie vorgestellten „System“ identifiziert wurde. Die spätere Lesart, die sich stattdessen auf die „Phänomenologie des Geistes“ stützt, war in vielerlei Hinsicht eine Reaktion auf die frühere. Nach 1945 „wurde dieser ‚dramatische‘ Hegelianismus, der das Thema des historischen Werdens durch Konflikt in den Mittelpunkt stellte, als mit dem Existentialismus und dem Marxismus vereinbar angesehen.“
Indem sie die Dialektik auf die Geschichte beschränkten, präsentierten die vorherrschenden französischen Lesarten von Jean Wahl, Alexandre Kojève und Jean Hyppolite Hegel tatsächlich als „eine philosophische Anthropologie anstelle einer allgemeinen Metaphysik“. Diese Lesart stellte das Thema „Begehren“ in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Ein Hauptthema war, dass „eine Vernunft, die danach strebt, allumfassend zu sein, die Wirklichkeit verfälscht, indem sie ihr ‚Anderes‘ unterdrückt oder verdrängt.“'" Obwohl sie nicht ausschließlich Kojève zugeschrieben werden kann, hat diese Lesart von Hegel das Denken und die Interpretationen von Denkern wie Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Claude Levi-Strauss, Jacques Lacan und Georges Bataille geprägt.
Kojèves Interpretation der „Herr-Sklave-Dialektik“ als Grundmodell der historischen Entwicklung beeinflusste auch den Feminismus von Simone de Beauvoir und das antirassistische und antikoloniale Werk von Frantz Fanon.
Amerikanischer Pragmatismus

Wie von Richard J. Bernstein dokumentiert, lässt sich der Einfluss Hegels auf den amerikanischen Pragmatismus in drei Momente unterteilen: das späte neunzehnte Jahrhundert, die Mitte des zwanzigsten und die Gegenwart. Der erste findet sich in den frühen Ausgaben des „Journal of Speculative Philosophy“ (gegründet 1867). Der zweite zeigt sich in dem anerkannten Einfluss auf bedeutende Persönlichkeiten wie John Dewey, Charles Peirce und William James.
Dewey selbst beschreibt diese Anziehungskraft folgendermaßen: „Es gab jedoch auch ‚subjektive‘ Gründe für die Anziehungskraft, die Hegels Denken auf mich ausübte; es erfüllte ein Verlangen nach Vereinigung, das zweifellos ein intensives emotionales Verlangen war, und doch war es ein Hunger, den nur ein intellektualisierter Gegenstand stillen konnte.“ Dewey akzeptierte vieles von Hegels Darstellung der Geschichte und der Gesellschaft, lehnte aber seine Auffassung von Hegels Darstellung des absoluten Wissens ab.
Zwei Philosophen, John McDowell und Robert Brandom (manchmal auch als die „Pittsburgh-Hegelianer“ bezeichnet), bilden nach Bernstein das dritte Moment von Hegels Einfluss auf den Pragmatismus. Obwohl sie den Einfluss offen anerkennen, behauptet keiner von ihnen, Hegels Ansichten nach seinem eigenen Selbstverständnis zu erläutern. Darüber hinaus sind beide erklärtermaßen von Wilfrid Sellars beeinflusst. McDowell ist besonders daran interessiert, den „Mythos des Gegebenen“, die Dichotomie zwischen Begriff und Intuition, zu zerstreuen, während Brandom vor allem daran interessiert ist, Hegels soziale Darstellung von Vernunftgebung und normativer Implikation zu entwickeln. Diese Aneignungen des Hegelschen Denkens sind zwei von mehreren „nicht-metaphysischen“ Lesarten.
Publikationen und andere Schriften
Veröffentlichte Artikel sind in Anführungszeichen gesetzt; Buchtitel sind kursiv gedruckt.
Bern, 1793-96
- 1793-94: Fragmente über Volksreligion und Christentum
- 1795-96: Die Positivität der christlichen Religion
- 1796-97: 'Das älteste systematische Programm des deutschen Idealismus' (Autorenschaft umstritten)
Frankfurt am Main, 1797-1800
- 1797-98: 'Entwürfe über Religion und Liebe'
- 1798: Vertrauliche Briefe über die früheren verfassungsmässigen Verhältnisse des Wadtlandes (Pays de Vaud) zur Stadt Bern. Eine vollständige Enthüllung der früheren Oligarchie der Berner Stände. Übersetzt aus dem Französischen eines verstorbenen Schweizers [Jean Jacques Cart], mit Kommentar. Frankfurt am Main, Jäger. (Hegels Übersetzung ist anonym veröffentlicht)
- 1798-1800: 'Der Geist des Christentums und sein Schicksal'.
- 1800-02: „Die Verfassung Deutschlands“ (Entwurf)
Jena, 1801-07
- 1801: De orbitis planetarum; Der Unterschied zwischen Fichtes und Schellings System der Philosophie
- 1802: „Über das Wesen der philosophischen Kritik im Allgemeinen und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Stand der Philosophie im Besonderen“ (Einleitung zur „Kritischen Zeitschrift für Philosophie“, herausgegeben von Schelling und Hegel)
- 1802: 'Wie der gesunde Menschenverstand die Philosophie nimmt, veranschaulicht durch die Werke des Herrn Krug'
- 1802: 'Das Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie. Darstellung seiner verschiedenen Modifikationen und Vergleichung der neuesten mit der alten
- 1802: 'Glaube und Wissen, oder die reflexive Philosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als kantische, jakobinische und fichteanische Philosophie'
- 1802-03: 'System des ethischen Lebens'
- 1803: 'Über die wissenschaftlichen Ansätze zum Naturrecht, seine Rolle innerhalb der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften'
- 1803-04: 'Erste Philosophie des Geistes (Teil III des Systems der spekulativen Philosophie 1803/4)'
- 1807: Die Phänomenologie des Geistes
Bamberg, 1807-08
- 1807: Vorrede: Über wissenschaftliche Erkenntnis - Vorrede zu seinem philosophischen System, veröffentlicht mit der Phänomenologie
Nürnberg, 1808-16
- 1808-16: „Philosophisches Propädeutikum
Heidelberg, 1816-18
- 1812-13: Wissenschaft der Logik, Teil 1 (Bücher 1, 2)
- 1816: Wissenschaft der Logik, Teil 2 (Buch 3)
- 1817: 'Rezension der Werke Friedrich Heinrich Jacobis, Band drei'
- 1817: 'Beurteilung der Vorgänge in der Ständeversammlung des Herzogtums Württemberg in den Jahren 1815 und 1816'
- 1817: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Auflage
Berlin, 1818-31
- 1820: Die Rechtsphilosophie, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Umrisse
- 1827: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 2. rev.
- 1831: Science of Logic, 2. Aufl., mit umfangreichen Überarbeitungen von Buch 1 (veröffentlicht 1832)
- 1831: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 3. rev. edn
Berliner Vorlesungsreihen
- Logik 1818-31: jährlich
- Naturphilosophie: 1819-20, 1821-22, 1823-24, 1825-26, 1828, 1830
- Philosophie des subjektiven Geistes: 1820, 1822, 1825, 1827-28, 1829-30
- Rechtsphilosophie: 1818-19, 1819-20, 1821-22, 1822-23, 1824-25, 1831
- Philosophie der Weltgeschichte: 1822-23, 1824-25, 1826-27, 1828-29, 1830-31
- Kunstphilosophie: 1820-21, 1823, 1826, 1828-29
- Religionsphilosophie: 1821, 1824, 1827, 1831
- Geschichte der Philosophie: 1819, 1820-21, 1823-24, 1825-26, 1827-28, 1829-30, 1831
Quellen
Primär
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1970). Michael John Petry (ed.). Hegel's Philosophy of Nature. Translated by Petry, Michael John. Allen & Unwin.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1971). Early Theological Writings. Translated by Knox, T. M. Chicago University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1975a). Aesthetics: Lectures on Fine Art. Translated by Knox, T. M. Oxford University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1975b). H. B. Nisbet (ed.). Lectures on the Philosophy of World History: Introduction. Translated by Nisbet, H. B. Cambridge University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1978). Michael John Petry (ed.). Hegel's Philosophy of Subjective Spirit. Translated by Petry, Michael John. D. Reidel Pub. Co.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1984a). H. S. Harris and W. Cerf (ed.). The Difference Between Fichte's and Schelling's System of Philosophy. Translated by Harris, H. S.; Cerf, W. SUNY Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1984b). Hodgson, P.C.; Brown, R.F.; Stewart, J.M. (eds.). Lectures on the Philosophy of Religion. Translated by Hodgson, P. C.; Brown, R. F.; Stewart, J. M. with the assistance of J.P. Fitzer and H. S. Harris. University of California Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1984c). Clark Butler and Christiane Seiler (ed.). The Letters. Indiana University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1998). H. S. Harris and W. Cerf (ed.). Faith and Knowledge. Translated by Harris, H. S.; Cerf, W. SUNY Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1990). "Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Outline [1917]". In Ernst Behler (ed.). Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Outline, and Other Philosophical Writings. Translated by Taubeneck, Steven A. Continuum.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1991a). H. B. Nisbet (ed.). Elements of the Philosophy of Right. Translated by Nisbet, H. B. Cambridge University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1991b). Suchting, W. A.; Geraets, Théodore F.; Harris, H. S. (eds.). The Encyclopaedia Logic: Part I of the Encyclopaedia of Philosophical Sciences with the Zusätze. Translated by Suchting, W. A.; Geraets, Théodore F.; Harris, H. S. Hackett.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995). Haldane, E. S.; Simson, Frances H. (eds.). Lectures on the History of Philosophy. Translated by Haldane, E. S.; Simson, Frances H. University of Nebraska Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1996). "The Oldest Systematic Programme of German Idealism". In Frederick C. Beiser (ed.). The Early Political Writings of the German Romantics. Cambridge University Press. [Urheberschaft umstritten]
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2010a). Michael J. Inwood (ed.). The Philosophy of Mind. Translated by Inwood, Michael J.; Miller, Arnold V. Oxford University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2010b). George di Giovanni (ed.). The Science of Logic. Translated by di Giovanni, George. Cambridge University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2010c). Lectures on Natural Right and Political Science: The First Philosophy of Right. Translated by Stewart, J. Michael; Hodgson, Peter C. Oxford University Press.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2011). Ruben Alvarado (ed.). Lectures on the History of Philosophy. Translated by Alvarado, Aalten. Wordbridge Publishing.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2018). Terry Pinkard (ed.). The Phenomnology of Spirit. Translated by Pinkard, Terry. Cambridge University Press.
- Baugh, Bruce (2003). French Hegel: From Surrealism to Postmodernism. Routledge.
- Beiser, Frederick C. (1993a). The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte. Harvard University Press. ISBN 9780674020696.
- Beiser, Frederick C. (1993b). "Hegel's Historicism". In Frederick C. Beiser (ed.). The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge University Press. ISBN 9780521387118.
- Beiser, Frederick C. (2005). Hegel. Routledge.
- Beiser, Frederick C. (2008). "Introduction: The Puzzling Hegel Renaissance". In Frederick C. (ed.). The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy. Cambridge University Press.
- Beiser, Frederick C. (2011). The German Historicist Tradition. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-969155-5.
- Bernstein, Richard J. (2010). The Pragmatic Turn. Polity Press.
- Bernstein, Richard J. (2023). The Vicissitudes of Nature. Polity Press.
- Bohman, James (2021), Critical Theory, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 ed.)
- Brandom, Robert B. (2019). A Spirit of Trust: A Reading of Hegel's Phenomenology of Spirit. Belknap Press of Harvard University Press.
- Bubner, Rüdiger (2007). "The Religion of Art". In Stephen Houlgate (ed.). Hegel and the Arts. Northwestern University Press.
- Burbidge, John (1993). "Hegel's Conception of Logic". In Frederick C. Beiser (ed.). The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge University Press.
- Burbidge, John (2006a). "New Directions in Hegel's Philosophy of Nature". In Katerina Deligiorgi (ed.). In Hegel: New Directions. McGill-Queen's University Press.
- Burbidge, John (2006b). The Logic of Hegel's 'Logic': An Introduction. Broadview Press.
- Butler, Judith (1987). Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. Columbia University Press.
- Carter, Ian (2022), Positive and Negative Liberty, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 ed.)
- Chalybäus, Heinrich Moritz (1860). Historische Entwicklung der spekulativen Philosophie von Kant bis Hegel. Leipzig: Arnold.
- Chitty, Andrew (2011). "Hegel and Marx". In Stephen Houlgate and Michael Baur (ed.). A Companion to Hegel. Wiley-Blackwell.
- Collins, Ardis B. (2013). "The Introductions to the System". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Croce, Benedetto (1915). What Is Living and What Is Dead of the Philosophy of Hegel. Macmillan.
- de Laurentiis, Allegra (2005). "Metaphysical Foundations of the History of Philosophy: Hegel's 1820 Introduction to the Lectures on the History of Philosophy". Review of Metaphysics. 41 (3): 3–31.
- de Laurentiis, Allegra (2009). "Absolute Knowing". In Kenneth R. Westphal (ed.). The Blackwell Guide to Hegel's Phenomenology of Spirit. Wiley-Blackwell.
- de Laurentiis, Allegra (2010). "Universal Historiography and World History According to Hegel". In Peter Liddel and Andrew Fear (ed.). Historiae Mundi: Studies in Universal History. Duckworth Press.
- de Laurentiis, Allegra (2021). Hegel's Anthropology: Life, Psyche, and Second Nature. Northwestern University Press.
- Löwith, Karl (1964). From Hegel to Nietzsche. Columbia University Press.
- Dien Winfield, Richard (1995). Systematic Aesthetics. University Press of Florida.
- Dien Winfield, Richard (2011). "Hegel's Solution to the Mind–Body Problem". In Stephen Houlgate and Michael Baur (ed.). A Companion to Hegel. Blackwell Publishing Ltd.
- deVries, William (2013). "Subjective Spirit: Soul, Consciousness, Intelligence and Will". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Dewey, John (1981). J.J. McDermott (ed.). The Philosophy of John Dewey. University of Chicago Press.
- di Giovanni, George (2000). "Factual Necessity: On H. S. Harris and Weltgeist". The Owl of Minerva. 31 (2): 131. doi:10.5840/owl200031212.
- di Giovanni, George (2003). "Faith Without Religion, Religion Without Faith: Kant and Hegel on Religion". Journal of the History of Philosophy. 59 (1): 3–31.
- di Giovanni, George (2009). "Religion, History, and Spirit in Hegel's Phenomenology of Spirit". In Kenneth R. Westphal (ed.). The Blackwell Guide to Hegel's Phenomenology of Spirit. Wiley-Blackwell.
- di Giovanni, George (2010). "Introduction". The Science of Logic. Cambridge University Press.
- di Giovanni, George (2013). "Moment". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Dickey, Laurence (1989). Hegel, Religion, Economics, and the Politics of Spirit 1770–1807. Cambridge University Press.
- Fackenheim, Emil L. (1967). The Religious Dimension of Hegel's Thought. Indiana University Press.
- Ferrarin, Alfredo (2007). Hegel and Aristotle. Cambridge University Press.
- Fritzman, J. M. (2014). Hegel. Polity.
- Guyer, Paul; Wood, Alan W. (1998), "Introduction to the Critique of Pure Reason [Editors' Introduction]", The Critique of Pure Reason, Cambridge University Press
- Harris, H. S. (1993). "Hegel's Intellectual Development to 1807". The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge University Press.
- Harris, H. S. (1995). Phenomenology and System. Hackett.
- Harris, H. S. (1997). Hegel's Ladder. Hackett.
- Heine, Heinrich (1834). "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland". Der Salon von H. Heine Volume: Zweiter Band (Volume 2). Hoffmann und Campe.
- Henrich, Deiter (1979). "Art and Philosophy of Art Today: Reflections with Reference to Hegel". In Richard E. Amacher and Victor Lange (ed.). New Perspectives in German Literary Criticism: A Collection of Essays. Princeton University Press.
- Hentrup, Miles (2019). "Hegel's Logic as Presuppositionless Science". Idealistic Studies. 49 (2): 145–165. doi:10.5840/idstudies2019115107. S2CID 211921540.
- Hodgson, Peter C. (1985). "Editorial Introduction". Lectures on the Philosophy of Religion, v.3: The Consummate Religion. University of California Press.
- Hodgson, Peter C. (2008). "Hegel's Philosophy of Religion". In Frederick C. (ed.). The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy. Cambridge University Press.
- Houlgate, Stephen (2005). An introduction to Hegel: Freedom, Truth, and History (2nd ed.). Blackwell.
- Houlgate, Stephen (2006). The Opening of Hegel's Logic: From Being to Infinity. Purdue University Press.
- Houlgate, Stephen (2007). "Introduction". In Stephen Houlgate (ed.). Hegel and the Arts. Northwestern University Press.
- Houlgate, Stephen (2013). Hegel's Phenomenology of Spirit. Bloomsbury Academic.
- Inwood, Michael (1992). A Hegel Dictionary. Wiley-Blackwell. ISBN 978-0631175339.
- Inwood, Michael J. (2013a). "Logic – Nature – Spirit". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Inwood, Michael (2013b). "Reason and Understanding". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Inwood, Michael (2018). "Editor's Introduction". The Phenomenology of Spirit. Oxford University Press.
- Jaeschke, Walter (1990). Reason in Religion: The Foundations of Hegel's Philosophy of Religion. University of California Press.
- Jaeschke, Walter (1993). "Christianity and Secularity in Hegel's Concept of the State". In Robert Stern (ed.). G.W.F. Hegel: Critical Assessments v.IV. Routledge.
- Jaeschke, Walter (2013). "Absolute Spirit: Art, Religion and Philosophy". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Kant, Immanuel (1998). Paul Guyer and Allen W. Wood (ed.). Critique of Pure Reason. Cambridge University Press.
- Kaufmann, Walter (1959). Hegel: A Reinterpretation. Doubleday.
- Kroner, Richard (1971). "Introduction". Early Theological Writings. University of Pennsylvania Press.
- Longuenesse, Béatrice (2007). Hegel's Critique of Metaphysics. Cambridge University Press.
- Magee, Glenn Alexander (2001). Hegel and the Hermetic Tradition. Cornell University Press. ISBN 0-8014-7450-7.
- Magee, Glenn Alexander (2011). The Hegel Dictionary. Continuum.
- Marcuse, Herbert (1999). Reason and Revolution (100th Anniversary ed.). Humanity Books.
- Marx, Karl (1978). "Theses On Feuerback". In Robert C. Tucker (ed.). Marx-Engles Reader (2nd ed.). Norton.
- Marx, Karl (1993). Grundrisse. Penguin Classics.
- Moland, Lydia L. (1993). Hegel's Aesthetics: The Art of Idealism. Oxford University Press.
- Mueller, G. E. (1958). "The Hegel Legend of 'Thesis-Antithesis-Synthesis'". Journal of the History of Ideas. 19 (3): 411–14. doi:10.2307/2708045. JSTOR 2708045.
- Peperzak, Adriaan T. (2001). Modern Freedom: Hegel's Legal, Moral, and Political Philosophy. Kluwer Academic Publishers.
- Pinkard, Terry (2000). Hegel – A Biography. Cambridge University Press.
- Pippin, Robert (1993). "You Can't Get There from Here: Transition Problems in Hegel's Phenomenology of Spirit". In Frederick C. Beiser (ed.). The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge University Press.
- Pippin, Robert (2008a). "The Absence of Aesthetics in Hegel's Aesthetics". In Frederick C. Beiser (ed.). The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy. Cambridge University Press.
- Pippin, Robert (2008b). "9. Institutional rationality". Hegel's Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. Cambridge University Press.
- Pippin, Robert (2019). Hegel's Realm of Shadows: Logic as Metaphysics in "The Science of Logic". University of Chicago Press.
- Pöggeler, Otto (2012). "Editorial Introduction". In J. Michael Stewart and Peter C. Hodgson (ed.). Lectures on Natural Right and Political Science: The First Philosophy of Right. Oxford University Press.
- Redding, Paul (2020). "Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 1. Life, Work, and Influence". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 16 September 2022.
- Rockmore, Tom (1993). Before and after Hegel: A Historical Introduction to Hegel's Thought. University of California Press.
- Rockmore, Tom (2013). "Feuerbach, Bauer, Marx, and Marxisms". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Rutter, Benjamin (2010). Hegel on the Modern Arts. Cambridge University Press.
- Siep, Ludwig (2021). Hegel's Phenomenology of Spirit. Cambridge University Press.
- Stahl, Titus (2021), Georg [György] Lukács, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 ed.)
- Stern, Robert (2002). Hegel and the 'Phenomenology of Spirit'. Routledge.
- Stern, Robert (2008). "Hegel's Idealism". In Frederick C. (ed.). The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy. Cambridge University Press.
- Stone, Alison (2005). Petrified Intelligence: Nature in Hegel's Philosophy. SUNY Press.
- Taylor, Charles (1975). Hegel. Cambridge University Press.
- Wandschneider, Dieter (2013). "Philosophy of Nature". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Westphal, Kenneth (1993). "The basic context and structure of Hegel's Philosophy of Right". In Frederick C. Beiser (ed.). The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge University Press.
- Westphal, Kenneth (2008). "Philosophizing about Nature: Hegel's Philosophical Project". In Frederick C. Beiser (ed.). The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy. Cambridge University Press.
- Westphal, Kenneth (2013). "Objective Spirit: Right, Morality, Ethical Life and World History". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Wicks, Robert L. (1993). "Hegel's Aesthetics: An Overview". In Frederick C. Beiser (ed.). The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge University Press.
- Wicks, Robert L. (2020). Simply Hegel. Simply Charly.
- Wolff, Michael (2013). "Science of Logic". In Allegra de Laurentiis and Jeffrey Edwards (ed.). The Bloomsbury Companion to Hegel. Bloomsbury Academic.
- Wood, Allen W. (1990). "Editor's Introduction". In H. B. Nisbet (ed.). Elements of the Philosophy of Right. Cambridge University Press.
- Wood, Allen W. (1991). Hegel's Ethical Thought. Cambridge University Press.
- "Hegel". Random House Webster's Unabridged Dictionary.
- "He-gel: Rechtschreibung, Bedeutung, Definition". Duden.
Externe Links
Gesellschaften
Audio und Video
- Vortrag von Terry Pinkard über Hegel: Eine Biographie, 10. Mai 2000
- Works by Georg Wilhelm Friedrich Hegel at LibriVox (public domain audiobooks)

Hegel-Texte online
- Hegel by HyperText, Referenzarchiv auf Marxists.org
Andere Quellen
- Andrew Chitty's (University of Sussex) Hegel Bibliography
- Deutscher Idealismus am IEP
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel im SEP
- Hegels Ästhetik im SEP
- Hegel: Soziales und politisches Denken am IEP
- Hegels soziale und politische Philosophie im SEP
- Pages with short description
- Articles with short description
- Short description with empty Wikidata description
- Use dmy dates from February 2024
- Articles with invalid date parameter in template
- Articles without Wikidata item
- Biography with signature
- Articles with hCards
- All articles with vague or ambiguous time
- Vague or ambiguous time from April 2024
- Articles with LibriVox links